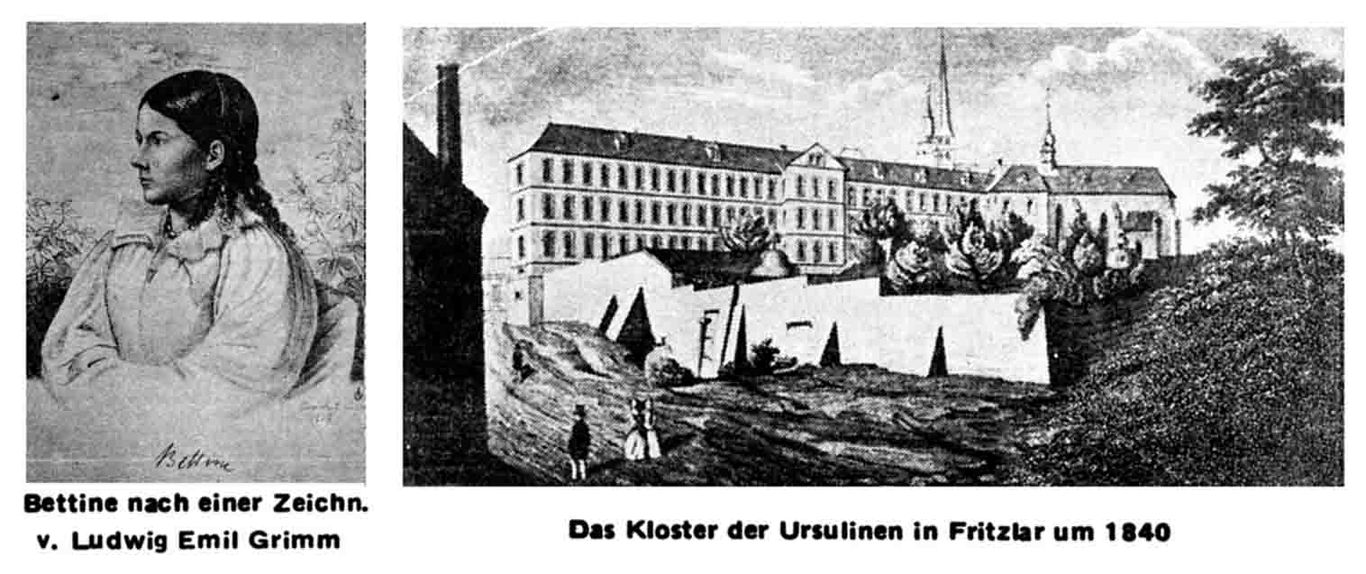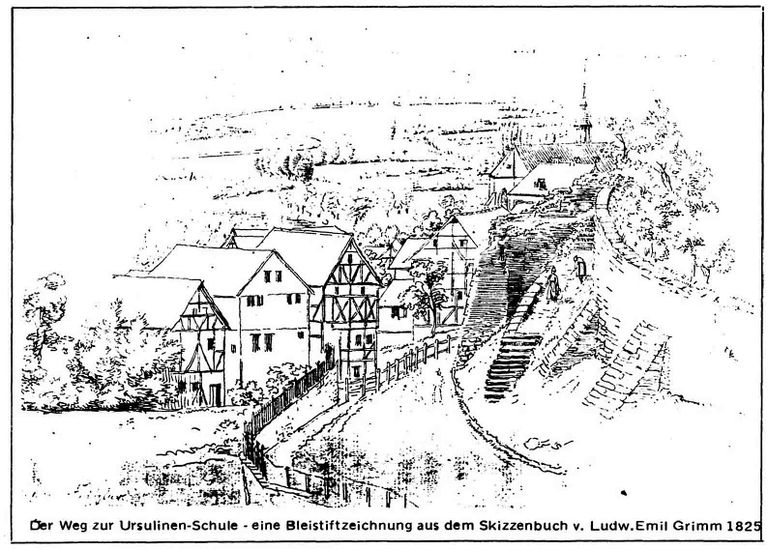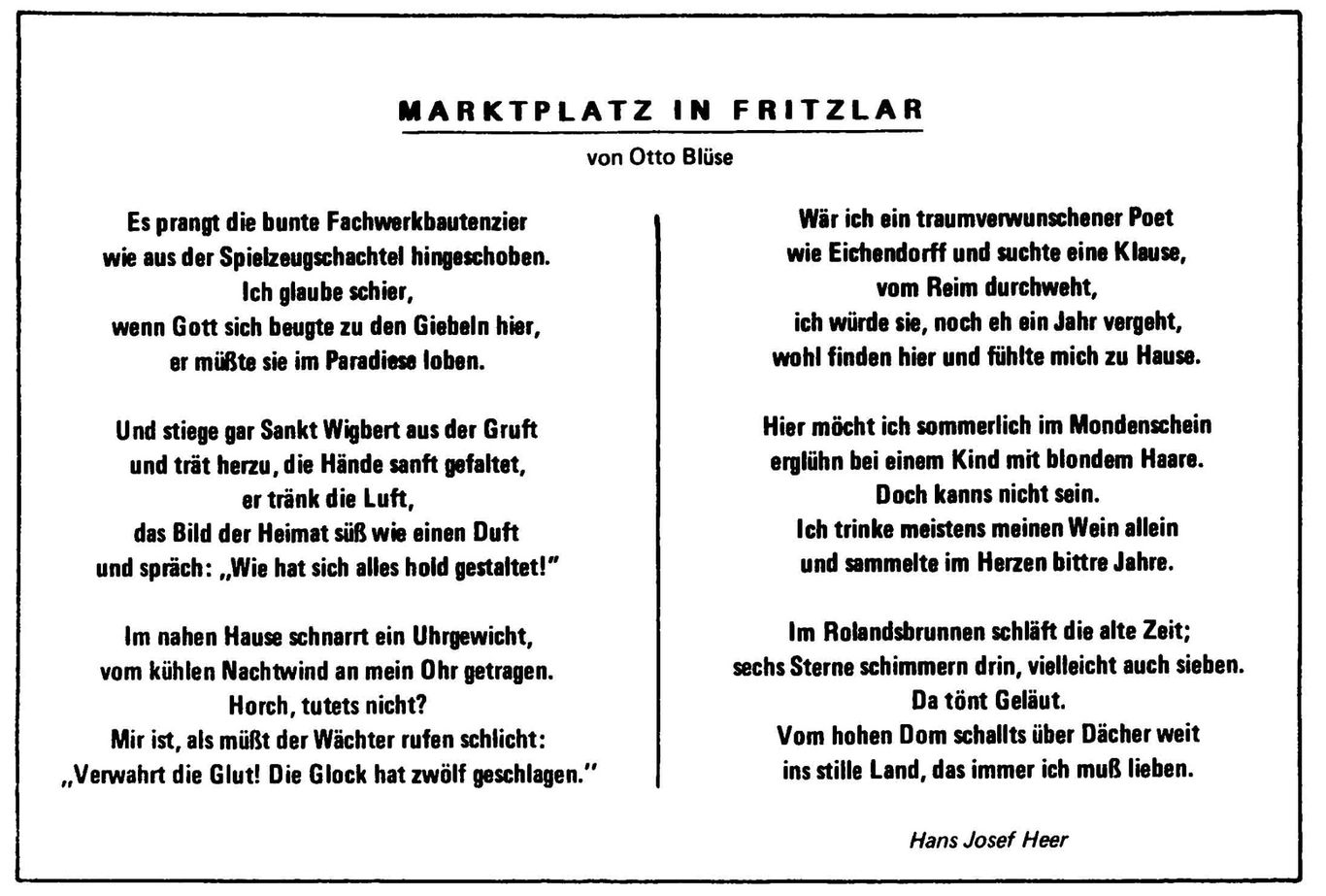Vorbemerkung
Ab wann sich der Bäckermeister Hans Josef Heer (6. Juli 1913 - 4. Oktober 1978) für die Geschichte seiner Heimatstadt interessierte, läßt sich leider nicht mehr feststellen. Ein erster Artikel über den Domschatz aus seiner Hand erscheint schon im Jahre 1938. Sowohl er als auch der Juwelier und Uhrmachermeister Ludwig Köhler, die beide miteinander befreundet waren, sollen in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg begonnen haben Dokumente, Bücher und Sachgüter zusammenzutragen. Dabei schaffte es Bäcker Heer im Laufe der Jahre eine umfangreiche Fach-Bibliothek aufzubauen, die im Souterrain seines neuerbauten Altersitzes am Blaumühlengäßchen schließlich mindestens eine komplette Regal-wand des Arbeitszimmers einnahm. Trotz seines berufstypischen und daher eher ungewöhnlichen Tagesablaufes fand er noch ausreichend Zeit zum Studium älterer und aktueller historischer und archäologischer Literatur, was ihm ein umfangreiches Wissen und große Kompetenz eintrug.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß er sowohl im Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein, der Ur- und frühgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft wie dem folgenden Museumsverein und in der Fritzlarer Sektion des Hessi-schen Geschichtsvereins von Anfang an eine wichtige Rolle spielte. Vor allem in ersterem, den man in gewisser Weise als den Vorläufer des späteren PRO FRITZLAR ansehen könnte, waren auch seine Fähigkeiten von Belang, sein historisches Wissen sowohl an seine Kollegen als auch an die auswärtigen Besucher der Stadt vermitteln zu können. Einen öffentlich organisierten Tourismus gab es ja zunächst nicht, und vor allem wurde er für Besucher der Stadt das, was der Domküster Paul Diederich war und sein Nachfolger, der gelernte Schreiner und Domküster Alfred Matthäi für die ehem. Stiftskirche St. Peter ("Dom") werden sollte. So fungierte er zeitweilig (neben August Boley, Ludwig Köhler und Hans Heintel) als wichtigster "Fremdenführer" (heute "Gästeführer"), das geschah in der Regel -wie bei seinen Nachfolgern zunächst auch- unentgeldlich (denn er war nicht darauf angewiesen und, was manchmal anschließende Einladungen durch die Besucher anging, ein Café besaß er ja selber!); es geschah aus Gastfreundlichkeit, und Bezahlung galt damals irgendwie als "schnöde" oder unanständig.
Möglicherweise fühlte er sich durch den Vortrag von Prof. Demandt am 13. Mai 1969 zur Königswahl Heinrichs I. im Jahre 919 dazu berufen, selber zur Schreibmaschine zu greifen um alles Wissenswerte einer weiteren Öffentlichkeit darzustellen, denn bislang sind uns seine Texte erst seit dem Frühjahr 1970 belegt. In diese Zeit fällt, wohl auch im Rahmen der Vorbereitung des 1250jährigen Ortsjubiläums und des Hessentages, die Anfrage an Prof. Demandt zum Datum der bonifatianischen Klostergründung.
Auch das Anlernen von Nachwuchskräften sah er als seine Aufgabe: zunächst bei Egon Schaberick und dann bei J.-H. Schotten, die später sein Wissen weitergaben (und zunächst ebenfalls seltsam berührt waren, wenn man ihnen ein "Trinkgeld" in die Hand drückte). Zur 1250-Jahrfeier, verbunden mit dem "Hessentag", erschien 1974 das Standardwerk "Fritzlar im Mittelalter" aus der Hand sehr bekannter Archäologen, Numismatiker, Kunst- und Mittelalterhistoriker (spez. Mediavisten) und anderer Koryphäen. Deren Ergbnisse gingen nicht soweit über die bisherigen Kenntnisse von Hans Josef Herr hinaus, als daß er sie in den letzten Jahren seines Lebens nicht auch für ein breites Publikum hätte aufbereiten können. Er veröffentlichte -wie schon zuvor- also weiterhin seine kleinen, bescheiden illustrierten Aufsätze im "Wochenspiegel" dem offiziellen Verkündigungsorgan (erst des Landkreises, dann) der Stadt Fritzlar, wo er seine Kenntnisse den "geneigten Lesern" mitteilte, und das bis kurz vor seinem, für uns (trotz seiner vorangegangenen Krankheit) doch überraschenden Tode. Diese Verlautbarungen bilden den eigentlichen Grundstock des in den 1990er Jahren von Gerhardt Methner und Dr. Schotten neuorganisierten Gästeführerwesens. So bot es sich an, speziell diese, seine Hinterlassenschaft noch einmal zusammenfassend im Internet zu präsentieren. Ob dabei jemals eine Voll-ständigkeit zu erzielen sein wird, ist momentan noch nicht absehbar, denn leider haben weder seine Bibliothek noch alle seine Aufzeichnungen ihn -aus unterschiedlichen Interessen- sehr lange überlebt. Ein Teil davon befindet sich inzwi-schen in den Räumen des Stadtarchivs.

1967-1974, danach:

Wochenspiegel Nr. 18/04, vom 01. Mai 1970, S. 1-2
RATHAUS in FRITZLAR
Nachstehend wird die bisher bekannte Literatur und das Schrifttum über das Fritzlarer Rathaus, das älteste Rathaus Deutschlands, aus dem 11. Jahrhundert stammend, veröffentlicht.
1830/40 Möller-Gladbach, „Denkmäler der deutschen Baukunst“. - 3. Teil, Titelblatt das Fritzlarer Rathaus vor 1838.
1841 Falkenhainer, C. B. N., „Geschichte Fritzlars“. Seite 81/82.
1864 Hoffmann u. Dehn-Rotfelser, „Die Stiftskirche St. Petri zu Fritzlar.“ Blatt VIII. Abbildung der Rathausruine.
1870 v. Dehn-Rotfelser u. Lotz. „Die Baudenkmäler im Reg. Bezirk Cassel“ - Seite 61.
1909 v. Drach C. Allhardt, „Die Bau- und Kunstdenkmäler im Reg. Bez. Cassel. Band II Kreis Fritzlar“. S. 16/17 und 4 Abb.
1912 Holtmeyer A., „Hessische Rathäuser“. S. XVII, XXIII, XLI, 2 Abb.
1918 „Hessenland“. „Das Fritzlarer Rathaus im Rahmen der älteren Ortsgeschichte“. Seite 65-67.
1910 „Jahrbuch der Denkmalpflege im Reg.-Bez. Cassel“, Becker Karl. „Das Rathaus zu Fritzlar“. S. 125 - 35 mit 8 Abbildungen.
1924 Jestädt Msgr. Wilh., „Festschrift zum 1200-jährigen Bestehen der Stadt Fritzlar 724 – 1924“, S. 38 - 2 Abbildungen.
1925 Jacob Bruno, „Fritzlar“. 16 Federzeichnungen v. W. Kramer, S. 6, 1 Abbildung.
1916 Rauch, Ch. , „Fritzlar ein kunstgeschichtlicher Führer“. - Seite 107 - 10 mit 7 Abbildungen.
1934 Thiele KA., „Das Rathaus“ im Fritzlarer Kreisanzeiger 30/8.
1939 Demandt Karl E., „Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Fritzlar im Mittelalter“. - Siehe Register.
1949 Demandt Karl E., Vortrag „Einwohnerschaft und Wirtschaftsleben im alten Fritzlar“. - 21 Maschinenseiten (Rathaus)
1950 Dehio-Gall. „Handbuch nördliches Hessen“. Rathaus S. 113.
1957 Demandt K. E., „Das Fritzlarer Patriziat“. ZHG Band 68, S. 98.
1959-64 „Gesammelte Zeitungsartikel aber die einzelnen Bauabschnitte des Fritzlarer Rathausbaues“.
1962 „Schriftwechsel zwischen dem Landeskonservator von Hessen und dem Geschichtsverein Fritzlar zwecks Wiederaufbau des alten Rathauses in Fritzlar.“ - 7 Maschinenseiten.
1962 Backes-Feldtkeller, „Kunstwanderung in Hessen“. S. 285.
1964 Bleibaum, Friedr. , „Das Rathaus von Fritzlar und seine Geschichte“, im „Bildband Fritzlar“. 4 Seiten und 4 Abbildungen.
1965 Kippenberger Albrecht „Das wiederhergestellte Rathaus in Fritzlar“. „Hessische Heimat“, Heft 1, S. 4-11 mit 8 Abbildungen.
1965 „Nordhessen“. Monographien deutscher Wirtschaftsgebiete. S. 29.
1967 „Landkreis Fritzlar-Homberg“ Kultur und Wutschafts-Chronik.
1968 „Stadt Fritzlar, Tradition und Fortschritt“. Bildb., 3 Abb.
gez. H.J. Heer
Wochenspiegel Nr. 21/04, vom 22. Mai 1970, S. 1-2
UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN
Das Fritzlarer Rathaus und seine Beamten und Angestellten um 1441
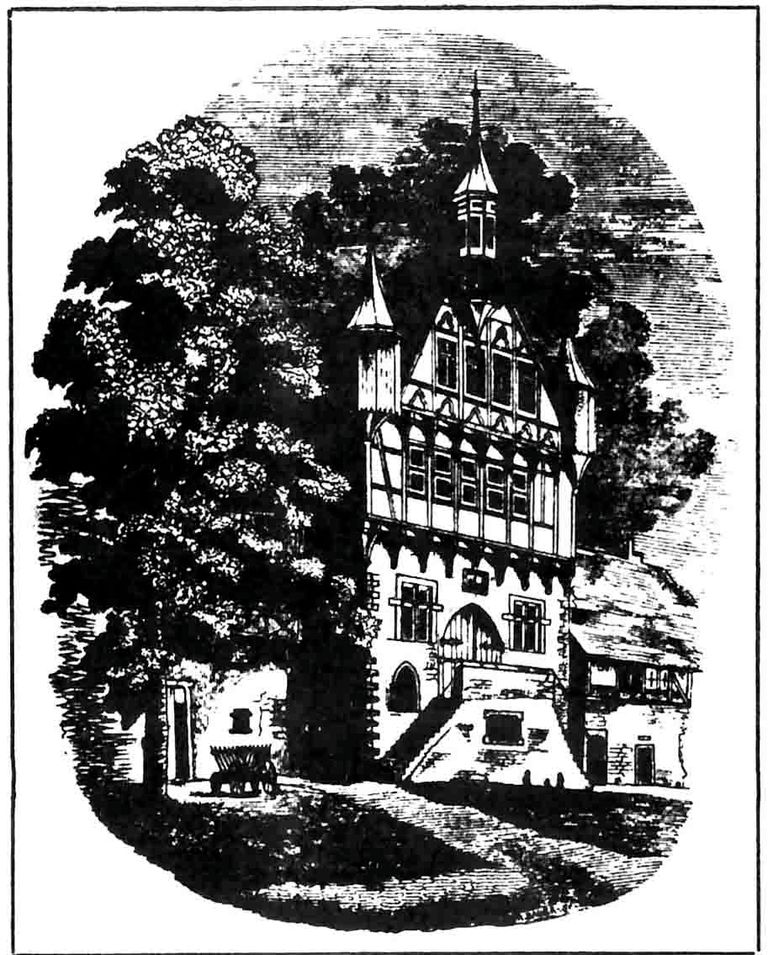
Das heutige Rathaus entspricht in seinem alten Bauteıl dem gotischen Rathausbau vom Jahre 1441 Die Raumeınteılung war nach den Urkundenüberlieferungen wıe folgt:
Unter der Freitreppe an der Südseite befand sich ein kleiner, gewölbter Gefängnisraum mit grosser vergitterter Lichtöffnung nach dem Friedhofe hin, in den Akten der damaligen Zeit "Narren- oder Thorenkasten" genannt;
später war er noch mit scharfen Latten ausgestattet. Rechts und links des Eingangstores vom Friedhof (heute Jestädtplatz) aus lagen die kleine Audienz und die Parthiestube. Dann folgte der große Raum, in dem sich die durch die Glocke zusammengerufenen Bürger zum Anhören der Bekanntmachungen des Rates versammelten, Zu diesem Raum konnte man auch von der Spitzengasse aus über eine hölzerne Treppe gelangen. Es handelt sich um den heutigen Sitzungssaal. In der Nordwestecke dieses Stockwerkes lag die Geschoßstube (Steueramt), in der auch das Stadtarchiv verwahrt wurde; in der Südwestecke die sogenannte "Jakobskammer", ein Bürgergewahrsam, ln dem malerischen Fachwerkgeschoß lagen die große Audienz - das ist der große Gerichtssaal und vier kleinere Räume. Der darüberliegende Boden diente zum Lagern der städtischen Fruchtvorräte, - Im massiven Unterstock lagen in der Südwestecke die große und die kleine Weinstube letztere wur-
de 1756 noch zum Gefängnis eingerichtet. In der großen Remise unter dem Nordflügel hing die große Stadtwaage.
Auch die Löschgerate waren darin verwahrt, Der tiefe, schöne Keller hatte ehedem als "Ratskeller" eine besondere Bedeutung, vor seinem Eingange stand eine Garküche, die 1631 beseitigt wurde Die kleinen Fenster waren vergittert und hatten Ladenverschluß. Der Keller gehört noch der ro-
mantischen Zeit an.
Als größtes Profangebäude der Stadt diente das Rathaus in älterer Zeit der Michelsbruderschaft, eine Vereinigung von Großkaufleuten, an bestimmten Tagen als Kaufhalle.
Aus dieser baugeschichtlichen Zusammenstellung ersieht man, daß das alte Rathaus über zahlreiche Räumlichkeiten verfügte. Dabei kommt einem unwillkürlich die Frage, wie groß mag wohl die Besetzung im Jahre 1441 an Beamte und Angestellte gewesen sein.
Diese Frage beantwortet uns Staatsarchivrat Dr. Demandt, in derı "Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Fritzlar im Mittelalter", Nach seiner Aufstellung waren um das Jahr 1450 insgesamt 157 Personen in der Stadtverwaltung beschäftigt. Sie setzen sıch wıe folgt zusammen:
2 Bürgermeıster, 12 neue und 14 alte Ratsleute, 2 Gemeindeworte, 1 Stadtschreıber, 2 Spitalmeister, 4 Schosser (Steuerbeamte), 2 Zapfer, 4 Baumeister, 7 Wächter auf den Wachten, 3 Stadtknechte 12 Gassenmeister, 2 Schützenmeister, 1 Büchsenmeıster, 1 Stadtarmbruster, 7 Torwächter, 14 Schlüsselhalter, 1 Turmhüter des Grauen Turmes, 2 Hornträger (Nachtwächter), 2 Brückenmeister. 1 Werkmeister, 1 Ziegelbrenner. 1 Weinschenk, 1 Weinrufer, 1 Ohmer (Eichmeister), 1 Böttcher, 2 Pfannenmeister. 1 Hopfenmesser, 1 Bierrufer, 1 Kohlenmeister, 4 Schröter, 1 Makler, 1 Stadtwagenaufseher, 1 Wollenwäger, 1 Moisicher (Garkoch), 1 Hainaer Almosenpfleger und sein Bäcker, 1 Gemeindeknecht, 3 Holzförster, 2 Handhabenmeister (zur Festnehmung von Verbrechern), 3 Ausreiter, 16 gehende Boten, 3 Hebammen, eine Meisterin und ein Wirt im Frauenhaus, 1 Schinder, 2 Feldschützen, 2 Mauerwächter, 1 Neustadtwächter, 1 Kuh- und 1 Sauhirt sowie ein Touengräber.
Diese umfangreiche Größe eines Verwaltungsapparates ist nur durch die bedeutende Stellung als Landeshauptstadt von Niederhessen im Mittelalter erklärlich.
H.J. Heer
Wochenspiegel Nr. 25/04, vom 19. Juni 1970, S. 1-2
UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN
Interessantes aus dem alten Fritzlar
Wie bereits hinreichend bekannt, hat sich bei der Belagerung der Stadt Fritzlar im Jahre 1232 durch den Landgrafen Konrad von Thüringen einiges getan. Wie uns dazu der alte Merian wörtlich in 1646 in seiner Städtebeschreibung über Fritzlar mitteilt, „seyen etliche lose Weiber auff die Stadtmauern gelauffen, haben den Hindersten entblöset, solchen über die Zinnen herausgereket und dem Landgrafen nachgeruffen, wann er nirgends hinzufliehen wüste, wollten sie ihm hiermit die Herberge gewiesen haben.“
Dieser Vorfall geistert durch viele alte Geschichtschroniken, aber solche Dinge haben sich auch andernorts in Deutschland abgespielt, wie der Curator Dr. Heinz-Eugen Schramm von der „Götz-von-Berlichingen-Academie“ in Tübingen, Verfasser des wissenschaftlich ominösen Buches „L.m.i.A.“, nachweist,
So war z. B. auch 1379 die schwäbische Reichsstadt Crailsheim belagert. Als nun die Lebensmittel knapp wurden, bestieg die korpulente Frau Bürgermeisterin die Stadtmauern, hob ihre Röcke und zeigte zwischen den Zinnen hindurch dem Feind ihre nackten Hinterbacken. Dies beeindruckte die Belagerer so, daß ihnen die Lust verging und sie ihr Vorhaben, die Stadt auszuhungern, aufgaben und abzogen.
Dr. Schramm weist nach, daß dieses Verhalten in alter Zeit mit Abwehrzauber zu tun hatte. Leider -hat dieser Zauber bei unserer Stadt versagt, die rauhen Mannen konnten einfach der herzhaften Einladung nicht widerstehen und so wurde unsere Stadt im Sturm genommen. Wie menschlich war doch früher die Kriegführung, schon ein solches Hintergesicht konnte den Frieden bringen.
Zur Ehrenrettung unserer weiblichen Vorfahren muß gesagt werden, daß ja nicht sie es waren, die unsere Stadt ins Unglück stürzten, sondern einwandfrei die gemeinen Weiber der damaligen Besatzungsmacht, die „Rheingauer“, die auch noch ausgerechnet der Erzbischof von Mainz und der Bischof von Worms mit sich herumschleppten, da konnte ja auch der Abwehrzauber nicht wirken.
Diese Niederlage hat nun wiederum unsere Vorfahren mächtig gewurmt, denn sie bauten an einer undichten Stelle ihrer sonst so erstklassigen Befestigungsanlage, zwischen dem Münstertor und dem Werkeltor, einer Strecke von kaum 100 Metern noch zusätzlich einen mächtigen Wehrturm, dem sie den drastischen Namen „callars“ (Kahlarsch) gaben. Ob sie denselben noch mit gewissen Abwehr-Emblemen ausschmückten, wie es bei mehreren Türmen heute noch in Deutschland zu sehen ist, kann leider nicht mehr festgestellt werden, denn es blieb nur noch der Stumpf des Turmes erhalten.
Der Germanist Prof. Theodor Haas, ein verstorbener Sohn unserer Stadt, befaßte sich 1925 in den Fuldaer Geschichtsblättern in seinem Aufsatz „Die Namen der Tore, Türme und Basteien der alten Stadt Fritzlar“ mit dem Turmnamen „Callars“ und weist in diesem Zusammenhang auch auf eine Flurbezeichnung „nassars“ (Naßarsch) hin. Man muß sich schon wundern, mit was für schwierigen Problemen sich unsere Wissenschaftler auseinandersetzen müssen.
Da nun Herr Dr. Schramm in seinem Werk diesen sonderbaren Abwehrzauber in ganz Deutschland und darüber hinaus an Türen und Toren, Häusern und Kirchen nachweisen konnte, richtete ich diesbezüglich mein Augenmerk auch auf unsere geschichts- und kunstreiche Stadt. Dabei mußte ich feststellen, daß auch Fritzlar von den eigenartigen Emblemen des Abwehrzaubers nicht verschont geblieben ist.
Betrachtet man die alte Marienkapelle gegenüber dem Rathaus, so sieht man am äußeren Eingang in der rechten oberen Ecke ein altes, bärtiges Männlein. Es streckt sein Hinterteil dem Rathaus zu, als wollte es sagen, die Bürgermeister und Ratsherren können mich mal, denn um 1350 - aus dieser Zeit stammt die Kapelle - hatten wir in Fritzlar immer zwei Bürgermeister und den dazugehörigen Stab an Beamten. Diese waren gleichzeitig Vollstrecker vom Finanzamt, Richter und Gefängnishalter, so daß es einem alten Steinmetz schon mal in den Fingern jucken konnte. Trotzdem läßt sich darüber noch streiten, ob wir es hier mit einem echten Abwehrzauber zu tun haben. Anders liegt der Fall im Kreuzgang des Domes, der ebenfalls aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammt. Dort befindet sich ein Konsolen-Abschlußfigürchen - das dritte an der linken Seite vom Eingang der heiligen Ecke, welches einwandfrei als Abwehrzauber angesehen werden muß, besonders da diese sitzende Figur auch noch mit der linken Hand dem Beschauer die blanken Hinterbacken anbietet.
Wir sehen also, daß auch bei uns in Fritzlar diese sonderbaren Sitten, die später unter dem Sammelbegriff „Götz-Zitat“ oder „Schwäbischer Gruß“ in der Literatur Eingang gefunden haben, zu Hause sind. Dennoch finde ich es reichlich übertrieben, wenn man in Schwaben Vereine gründet zur Erhaltung des Schwäbischen Grußes. In Hessen sehe ich diesbezüglich keine Gefahr, denn dieses Unmutsventil findet sogar noch in klerikalen Kreisen seine Anwendung, wie mir ein alter Fritzlarer Pfarrer glaubwürdig bestätigte.
So hatte vor etlichen Jahren sein Amtsbruder eine hitzige Auseinandersetzung in Bauangelegenheiten mit dem zuständigen Domkapitular. Da keine Einigung erzielt wurde, warf der Pfarrer dem Domkapitular das Götz-Zitat an den Kopf, worüber sich der Domkapitular bitter bei seinem Bischof beschwerte. Der Bischof konnte ihn nur beruhigen mit den Worten: „Aber dazu sind Sie ja nicht verpflichtet.“
Die wissenschaftliche Forschung des Herrn Dr. Schramm hat erwiesen, daß das Götzzitat in der ganzen,Welt gebraucht wird. Deswegen sei unserer begeisterungsfähigen Jugend noch mitgeteilt, falls sie jemals mit den Jüngern „Mao' s“ zusammentreffen sollten und diese sie mit den blumenreichen Worten China' s begrüßen die da lauten: „Küß mich im Tal der lauen Winde“ so ist dies keineswegs sehr freundlich, sondern es handelt sich abermals um den vermaledeiten Abwehrzauber bzw. um das deutsche „Götz-Zitat“.
H. J. Heer
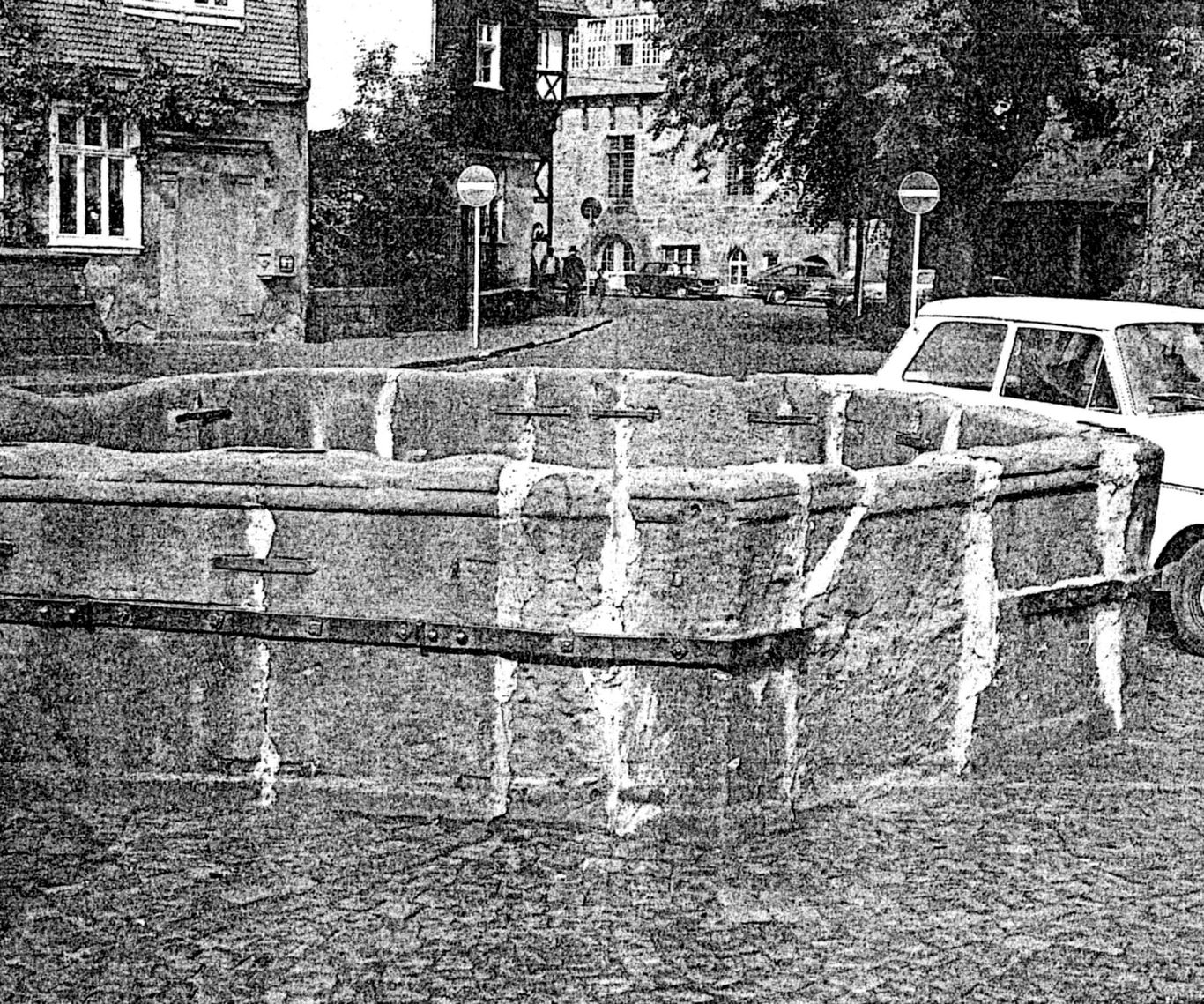
Der >>Kumb<< am Domplatz
Nachdem bereits im Jahre 1969 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, den ehemaligen Brunnen am Dom wieder in seinen alten Zustand zu versetzen, und die entsprechenden Mittel im diesjährigen Haushalt vorgesehen sind, wurden in diesen Tagen die Arbeiten in Angriff genommen.
Von Herrn Bäckermeister Heer, Fritzlar, wurde uns ireundlicherweise eine Broschüre überlassen, die auch über den „Kumb“ berichtet.
Im Mittelalter gehörte der Brunnen zu der „Wasserkunst“, durch welche die Altstadt Fritzlar hauptsächlich mit Flußwasser versorgt wurde. Diese „Wasserkunst“ reicht bis in das 14. Jahrhundert zurück. Der Brunnen diente gewissermaßen als Wasserbehälter oder Wasserspeicher. Nach Angaben des Herrn Heer war der Brunnen noch zu dessen Kindheit ca. 20 m tief. Er wurde wegen der bestehenden Gefahr dann durch die Stadt aufgefüllt.
1609 legte der Stadtrat die „Wasserkunst“ unter das St. Catherinenkloster (heute Ursulinenkloster) und erlangte von dem Stift die Erlaubnis, das Wasser der Steingosse hierzu verwenden zu dürfen. Später wurde sie auch in der städtischen Mönct,emühle angebracht. „Dieses Kunstwerk treibt das Wasser in eisernen Röhren den Mühlberg und Amberg hinauf. Hier theilt sich ihr Gang ehemals in zwei Arme, deren einer über den oberen Friedhof an der Johanniskirche hin in die Küche des Hochzeitshauses lief, der andere aber durch die Krämen in das obere Brauhaus führte, dieses, so wie das Wasserbecken auf dem Markte (Rolandsbrunnen) versorgte, dann weiter durch die Werkelgasse in das untere Brauhaus (an der Stelle, an der heute das Café Heer steht), und hier, wo er endete, am Klobesplatze (heute steht hier das Postamt. - Klobes = Klaus = Nikolaus, daher Nikolausstraße) das ihm auf dem weiten Wege noch gebliebene Wasser zu jedermanns freiem Gebrauch, ausgoß. Der erstgenannte Arm ist längst abgeschnitten, der Lauf des letzteren gehet seit 1799 nicht mehr durch die Krämen, sondern über den unteren Friedhof durch die Fischgasse hin.“
Weiterhin ist über die "Wasserkunst" folgendes zu lesen:
1698 ist zu der hiesigen Wasserkunst ein eiserner Grummeling zu Orb in der Grafschaft Waldeck gegossen worden. 1703, 27. Septembris ist das Kunst Rath samt einem neuen Bäder außer dem Haus gelegt, Undt so wohl eingerichtet, daß mit viel leichterem Trieb noch so viel Wasser herauß in die Statt gebracht worden. 1704, seyndt die Waßer Röhren von der abladung auffm freydhoff ahn biß zum Hochzeitshauß auffgehoben, Von Neuem ausgebrent Undt zu geringerer Circumferentz Unter den Krähmen her angelegt worden. 1725 sind die 2 Stiefeln durch Meister Constantin Ulrich aus Hersfeld umgegossen, die Ventile reparirt und das Geleide samt den Gabeln länger gemacht.
(Der Meister bekam 100 Taler und für jedes Pfund über das alte Gewicht 1/2 Gulden).“
Aufnahme: E. Meiers
Wochenspiegel Nr. 40/04, vom 02. Oktober 1970, S. 1-2
UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN
-WUNDERLICHES RECHT AUS DEM ALTEN FRITZLAR-
(Auf Ehebruch stand Todesstrafe)
Als neulich bei der Suche nach alten Kirchengrundmauern am „Roten Hals“ Gebeine zum Vorschein traten, kam mir zum Bewußtsein, daß an dieser Stelle der Nordseite des Domes, die Hingerichteten sowie die Erschlagenen oder sonst verunglückten Fremden hier ihre Begräbnisstätte fanden. Wegen der Hingerichteten gab der Volksmund dem Nordeingang des Domes den grausigen Namen „Der rote Hals“. Bei dieser Ausgrabung kam auch ein vollständiger Schädel zum Vorschein, bei dessen Anblick mir folgende geschichtliche Tatsache, aufgezeichnet im Fritzlarer Memorialbuch, in Erinnerung kam.
Der Fritzlarer Bürger und Ehemann Christian Andres war 1662 so unvorsichtig, sich eine Freundin zuzulegen. Sein Eheweib war keineswegs damit einverstanden und erhob Klage beim peinlichen Gericht der Stadt Fritzlar.
Dadurch setzte sie eine, für unsere heutigen Begriffe, grausige Gerichtsmaschinerie in Gang. Der Schultheiß und die Bürgermeister mit den Schöffen hatten nun das erste Recht des „Angriffs“ (Arretierung). Diese nun wiederum setzten ihre städt. „Handhabenmeister“ in Trab, die dann den armen Sünder festnahmen und in die Bürgergewahrsam im Rathaus einsperrten. Gleichzeitig wurde auch die Zuhälterin gefaßt und in den Steingossenturm (auch Hexenturm) gesteckt. Christian Andres wurde wegen Ehebruch vom peinlichen Gerichte zu Fritzlar nach Anhörung des „Fiscals“ (Mainzer Obergericht) zum Tode verurteilt.
Als das Urteil auf dem Rathaus verlesen wurde, war das Gericht in gewohnter „positur“, Schultheiß, Bürgermeister und die zwei Blutschöffen, denen der Zöllner den Gerichtsstab vorantrug, zum Siechenrasen gegangen. Der arme Sünder aber wurde gesondert von den gewappneten Bürgern in Begleitung der beiden Stadtpfarrer und viel Volk zur Richtstätte gebracht. Dieselbe befand sich neben dem Siechenhaus vor dem Weidenbaum auf der linken Seite des Fahrweges, wo ein großer Kreis geschlagen war. (Wahrscheinlich da, wo heute der Kreuzgarten ist). In diesem Kreis war das Gericht versammelt. Nachdem der Richter ihm nochmals sein Urteil vorgelesen hatte und den Gerichtsstab zerbrach, erfolgte durch den Scharfrichter die Enthauptung des armen Sünders, der Tags zuvor „ufm rathuse“ das hl. Abendmahl empfangen hatte. Damit war diese Familientragödie noch keineswegs zu Ende.
Der Sohn des Hingerichteten fühlte sich irgendwie verpflichtet, entweder aus Familientradition oder weil es sich bei der Freundin seines Vaters um eine reizende Hexe handelte, einzugreifen.
Er befreite dieselbe aus dem Steingossenturm und ging buchstäblich mit ihr türmen. Sie wurden aber nach einiger Zeit von den eifrigen Handhabenmeistern wieder aufgegriffen. Der Sohn wurde zu einem halben Jahr Schanzarbeit an der Fritzlarer Stadtbefestigung verurteilt, die Ehebrecherin aber an den Rathauspranger gestellt, mit Ruten bestrichen und des Landes verwiesen.
Der Stadtschreiber verzeichnete geradezu hohnvoll in dein Fritzlarer Memorialbuch, daß die Frau des Ehebrechers die ganzen Gerichtskosten, die damals wie heute: recht hoch waren, zu zahlen hatte.
Hätten wir heute noch so harte Sitten, stände der neue Friedhof noch viel dringlicher auf dem städtischen Etat.
Hans Josef Heer
Wochenspiegel Nr. 42/04, vom 16. Oktober 1970, S. 1-3
UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN
Das Rathaus zu Fritzlar und seine Bürgermeister.
Das aus dem 11. Jahrhundert stammende älteste Amtshaus in Deutschland, noch heute der städtischen Verwaltung dienen-de Rathaus zu Fritzlar, war Sitz des Erzbischofs von Mainz als dem Grundherrn, dem die Stadt gegen Ende des 11. Jahrhun-derts vom Reiche übertragen war. lm Jahre 1109 erneuerte der Erzbischof Ruthard der Fritzlarer "familia" die überkomme-nen Rechte, daß in "fridesIariensi praetorie" der Vogt jährlich die "dreitägigen Dinge" abzuhalten habe. Damals wurde in sei-nen ursprünglich offenen Lauben des unteren ebenerdigen Stocks das Gericht des Fritzlarer Vogts, des weltlichen Richters über die Hörigen, abgehalten. Mit der Auflösung der Fritzlarer "familia" im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert aber wur-de naturgemäß auch das Amt des Vogtes gegenstandslos. Deswegen schenkte Landgraf Konrad von Thüringen 1231 dieses Gerichtshaus dem Kloster Berich, von welchem das Kloster Haina kurze Zeit später dasselbe erwarb.
Dieses steinerne Gebäude verkaufte das Kloster Haina 1266 an den Fritzlarer Ratsmann und Schultheiß Swineouge zu le-benslänglichem Besitz. Nach dem Tode Hartmuds übertrug es Haina im Jahre 1274 gegen einen jährlichen Zins auf Bürger-meister und Rat zum gemeinnützigen Gebrauch der Stadt, das heißt als Rathaus.
Mit der neuen Bestimmung des alten romanischen Vogteihauses zum städtischen Rathaus, lassen sich auch die Anfänge des Fritzlarer Rates und seine Bürgermeister nachweisen. Der Fritzlarer Rat setzte sich jeweils durch die 14 Alten und 14 Neuen gewählten Ratsschöffen zusammen. Von diesen 28 Schöffen saßen die 14 Neuen ein Jahr lang im Rat bis auf "unser Lieben Fraue Abend" (1. Februar), wo sie dann abtraten und ein Jahr lang den Alten Rat bildeten, bis sie am folgenden 1. Febr. wieder in den neuen Rat einrücken konnten. Bei wichtigen Entscheidungen trat Alter und Neuer Rat gemeinsam in Funktion.
Jeweils der Neue Rat wählte die zwei Bürgermeister, den Regierenden und den Vizebürgermeister. Die Amtszeit der Bürger-meister war von vornherein auf ein Jahr begrenzt. Die Wahl traf mit großer Regelmäßigkeit fast jeden der Ratsleute einmal, dadurch erhält die Bürgermeisterliste ihre Vollständigkeit, auch selbst wenn einige Jahre in den Unterlagen fehlen. Der Erst-genannte ist immer der Regierende, der Zweite der Vizebürgermeister. Bei Bürgermeisterpaaren, die mehrere Jahre zusam-men im Amt waren, stehen die weiteren Dienstjahre hinter den Namen.
Die 167 Bürgermeisternamen in 700 Jahren sind besonders für die Deutsche Familienforschung ein interessantes Forschungsgebiet.
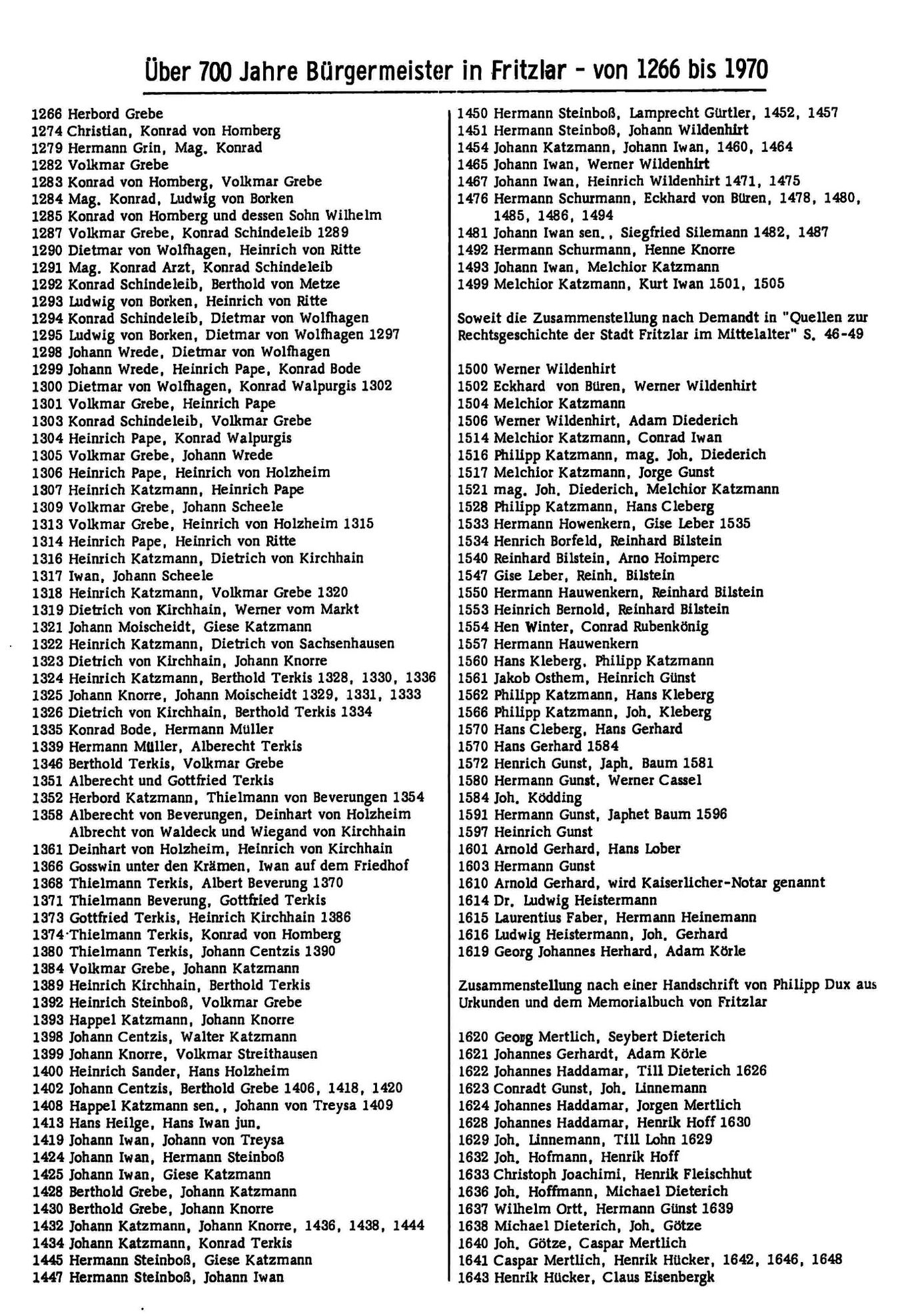
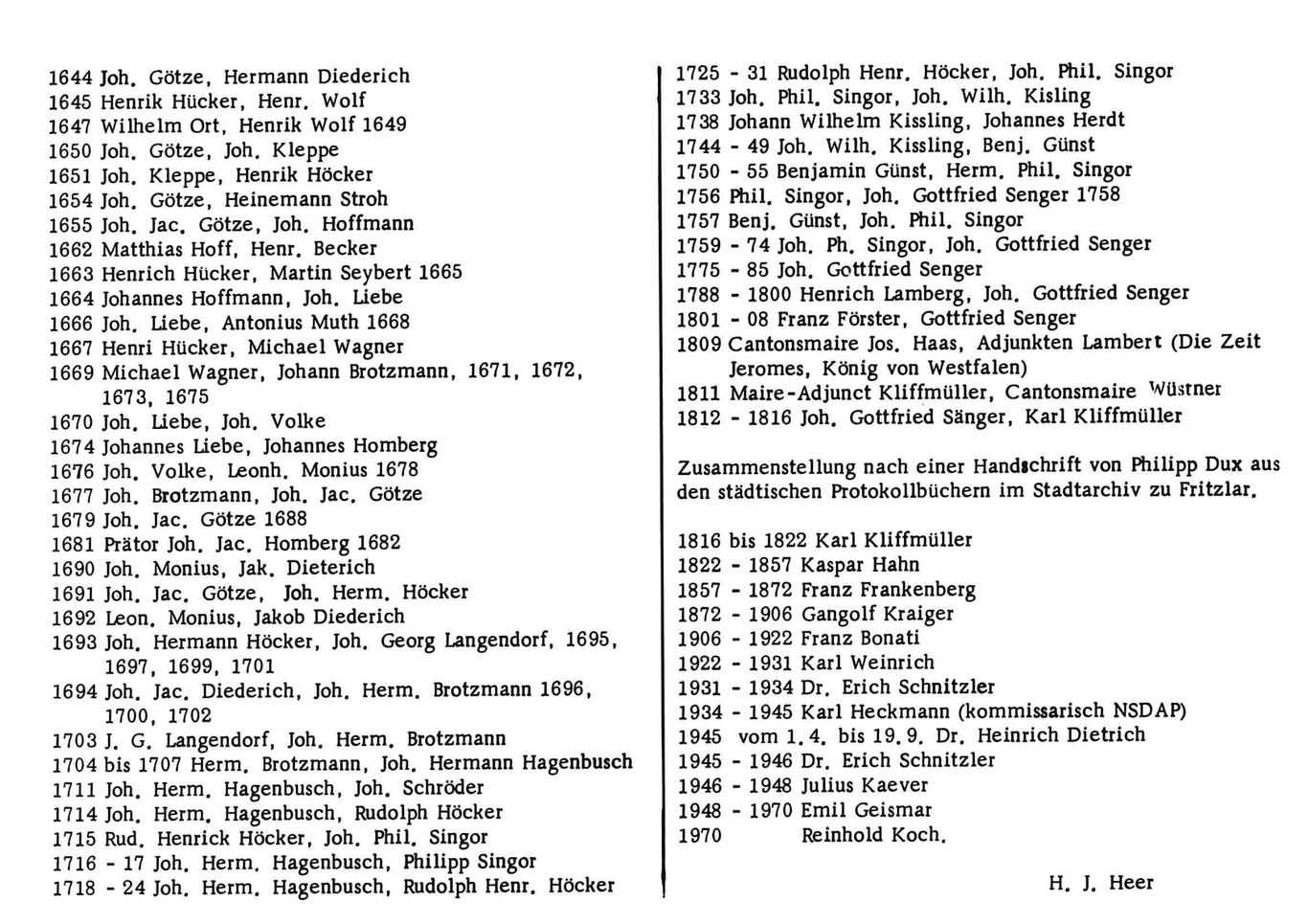
Wochenspiegel Nr. 12/05, vom 19. März 1971, S. 1-2
Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden,
ein Beitrag zur Stadtgeschichte
Die Gassen- und Straßennamen der deutschen Städte sind Denksteine der Stadtentwicklung und Stadtgeschichte. Was die Adern für den menschlichen Körper bedeuten. das sind die Gassen und Straßen für eine Stadt, In ihnen pulsiert das Leben, das einer Stadt Sinn und Zweck verleiht, ihr das Gepräge gibt. Aus ihnen kann man die Geschichte eine Stadt in der Mannigfaltigkeit ihrer Lebensäußerungen ablesen,
Wer liebevoll den alten Gassennamen nachspürt. der lernt aus ihnen Schlüsse zu ziehen auf Sprache, Denken und Fühlen der Siedler, die vor Jahrhunderten auf diesem Grund und Boden weilten und die jetzige Kulturlandschaft mit ihren Wegen und Stegen, ihren Wällen und Gräben, kurzum mit ihrem reizvollen Stadtbild geschaffen haben, Deshalb haben diese Namen etwas von vergilbten Urkunden an sich, die uns aus alten Zeiten berichten.
Es besteht jedoch ein gewaltiger Unterschied zwischen den alten und neueren Straßennamen. Diese sind durch Beschluß der städtischen Körperschaften am grünen Tisch entstanden. Sie gedenken oft berühmter Persönlichkeiten, die zu der Stadt in keinerlei Beziehung gestanden haben, die dieser Ehrung gar nicht bedurft hätten, weil ihr Ruhm auch ohnedies gesichert ist. Wesentlich anderer Art sind die alten Gassennamen einer Stadt, denn alle diese Namen haben eine Geschichte. Sie standen nicht auf einem Straßenschild, und doch haben sie die Jahrhunderte überdauert. Auch sollte man in der alten Bezeichnung „Gasse“ nicht etwas Minderwertiges sehen, denn Gasse ist die mittelalterliche Benennung für Straße und zeugt immer für ein hohes Alter einer Stadt. Die berühmteste Geschäftsstraße in Salzburg ist heute noch die alte Getreidegasse, aus der auch Mozart stammte und viele solcher alten Gassennamen werden heute noch in unseren deutschen Städten geführt.
Kommen wir jetzt zur Stadt Fritzlar. Um dieses Thema einigermaßen übersehen zu können, teile ich den Grundriß unserer Stadt innerhalb der alten Stadtmauer in vier Bezirke, den Dombezirk, den Marktplatzbezirk, den Bezirk an der evangelischen Stadtkirche und den Bezirk um das alte Deutsch-Ordenshaus an der Fraumünsterstraße, wie die früheren Stadtbezeichnungen lauteten- Stadtteile A, B, C und D.
Beginnen wir mit dem ältesten Teil unserer Stadt, dem Dombezirk. Dort liegt am oberen Ende des Domplatzes wohl die älteste Gasse, der Ziegenberg. Eine Wegeverbindung vom Büraberg durch die Ederfurt und die untere Neustadt zum Domplatz. Sein Name weist uns in die vorchristliche Zeit, wo noch dem heidnischen Gotte Donar an der Domreiche, am Platze des heutigen Domes, die Ziegenopfer dargebracht wurden. Deswegen kamen auch noch in der vorreformatorischen Zeit die Bewohner von Geismar einmal im Jahr mit einem Baum zum Dom, um hier das Baumfest zu feiern, welches an die Fällung der Domreiche durch Bonifatius erinnerte,
Auf dieser alten Kultstätte wurde nach der Fällung der Domreiche Fritzlars erste christliche Kirche mit einem Benediktinerkloster erbaut. Bei der Legung der Fußbodenheizung im vergangenen Jahr hat die Fundamentforschung ergeben, daß diese erste steinerne Kirche schon eine große beachtliche Bauanlage gewesen sein muß. Das Benediktinerkloster wandelte sich etwa um 1000 in ein Chorherrenstift. Um 1250 entstand der heutige Dom, der dritte an dieser Stelle, seit dieser Zeit haben wir den Dombezirk so wie er sich uns heute noch darbietet.
In der Vergangenheit nannte man diesen Bezirk die alte „fritzlarer familia“, gemeint war damit das St. Peter-Stift, der Dom und seine 18 Kurien, die Wohnhäuser der meist adligen Stiftsherren mit ihren Hörigen.
Gehen wir mal den vergangenen Spuren der verschiedenen Kurien nach. Da wäre zuerst die Propstei zu nennen, die Wohnung des Fritzlarer Propstes, sie stand links vom Wege - zur sogenannten heiligen Ecke und ist im vergangenen Jahr abgebrochen worden, dessen freier Platz soll in Zukunft Anlage werden.
Die hohe Stellung, die der Propst von Fritzlar in ganz Hessen eingenommen hatte, machte die Propstei selbst für Fürsten und Grafen begehrenswert. In der langen Reihe der Fritzlarer Pröpste finden wir einen Landgrafen von Hessen, mehrere Grafen von Ziegenhain, einen Grafen von Waldeck, einen Grafen von Isenburg und Büdingen, zwei Grafen von Nassau und sogar einen Kardinal.
Der kleine Weg zur „Heiligen Ecke“ hat seinen Namen von der Nische, in welcher eine Figur des Gründers des Domes, der heilige Bonifatius, aufgestellt ist. Neben der Propstei, getrennt durch das Dechaneigäßchen, steht die heutige Dechanei, eine der ältesten Kurien mit gotischem Staffelgiebel. Hinter dem Dechaneihof lag früher noch eine kleine Kurie, genannt „der halbe Hof“ am Zuckmantel. Der eigenartige Name „Zuckmantel“ weist auf ein hohes Alter hin, im Mittelalter nannte man Rauben „Zucken“ und den halbhohen Rundbau an der Stadtmauer „Mantel“, so daß man unter dem Namen Zuckmantel „Raubbefestigung“ zu verstehen hat. Neben der Dechanei stand die „Kurie am Friedhof mit dem Brunnen“, die vor zwei Jahren abgebrochene Küsterei. Sie war schon 1285 die Kurie des Magister Wilhelm. An ihr vorbei geht das sogenannte Küstergäßchen, an dessen unterem Ende stand auf dem heutigen Grundstück von Dr. Hegewald die „Kurie mit der Steinsäule am Steingossentor“, erbaut um 1320. Ihr gegenüber lag die „Kurie am Steinweg“ heute Haus Gerhard Faupel. Der Steinweg hat seinen Namen von den Steinmetzen, die früher dort wohnten. Sie waren wohl von der ehemaligen Dombauhütte hier seßhaft geworden und sind die Steinmetzen von den kunstvollen Grabsteinplatten, die noch in großer Zahl erhalten sind.
Neben der Kurie am Steinweg lag rechts die „Kurie am Haspel“ oder auch der grüne Hof genannt. Die Haspel war ein Drehrad, das nur den Fußgängern erlaubte, den Weg zum Totenhof am Dom zu begehen.
Die Holzgasse, heute Neustädter Straße, hatte ihren Namen von dem Weg nach dem im Jahre 1402 zerstörten Dorf Holzheim. Es lag etwa in der Gegend, wo heute der Bauernhof Mander am Rothhelmshäuserweg liegt.
Den beiden zuletzt genannten Kurien gegenüber lag die „Kurie auf der Ecke zur Münstergasse“ heute Bürgerhaus. Neben dieser lag die kleine „Kurie in der Holzgasse“ an der Stelle, wo 1896 die jüdische Synagoge erbaut wurde und die man in den 40ger Jahren zerstörte, heute Haus Zahnarzt Böhm. Ihr fast gegenüber lag ebenfalls eine Kurie, an die noch der Eingangsbogen zur heutigen städtischen Bedürfnisanstalt erinnert.
Wir gehen wieder zurück zum ehemaligen unteren Friedhof, heute Dr. Jestädtplatz. Er erhielt den Namen zu Ehren des verstorbenen Stadtdechanten „Monsignore Dr. Wilhelm Jestädt“, der sich große Verdienste um die Restaurierung des Domes, die Errichtung des Dommuseums erworben hatte und der Schriftsteller der „Festschrift zur 1200 - Jahrfeier der Stadt Fritzlar“ war.
An der Stelle der früheren Lateinschule, heute Pfarrheim, lag die „große Kurie am Friedhof“, an der Stelle der früheren Präparandenanstalt, heute Gymnasium, die „kleine Kurie am Friedhof“.
Ein Stück Mittelalter ist uns geblieben in der „Kurie in der Fischgasse“, ihr gegenüber lag die „Kurie bei der Fischgasse“, deren Reste im Hof des ehem, kath. Kindergartens stehen. Die Fischgasse hat ihren Namen von der früheren Fischbank, heute das Haus der Fleischerei Krause. Anstelle des ehem. katholischen Kindergartens war die „Kurie gegen der Luchten“ gelegen, eine der alten städtischen Beleuchtungen. Ihr folgte die „Kurie auf dem Friedhof“ beim Rathaus, auf dessen Platz der neue Rathausanbau steht.
Am oberen Friedhof, 1827 Paradeplatz genannt, wegen der hessischen Husaren, die ihre Kaserne im Hochzeitshaus hatten und diesen Platz als Exerzierplatz benutzten, heute Domplatz, standen die restlichen drei anderen Kurien. Die „Kurie ob dem Friedhof“, heute Haus Marienburg Dr. H. Dietrich, an dessen Haus noch die Hankrat'schen Wappen angebracht sind. Die „Kurie beim Schulhof“ ist das Haus neben dem neuen katholischen Kindergarten mit dem großen gotischen Torbogen. Sie war schon 1247 vom Scholastiker Heinrich von Rüsteberg bewohnt, welcher im genannten Jahr Bischof von Hildesheim wurde. Als letzte der 18 Kurien ist noch das „Kapitelhaus“, heute die Waage bei dem Kumpf, am Domplatz, zu nennen. In der 800-jährigen Geschichte des Fritzlarer St. Peter-Stift lassen sich etwa 450 meist adlige Stiftsherren nachweisen. Damit wäre am Dombezirk das geistig-kirchliche Zentrum unserer Stadt in groben Zügen beschrieben, das weltlich-politische Zentrum wird in der Fortsetzung besprochen.
H. J. Heer
GLOSSAR:
KURIE = Päpstliche Zentralbehörde
SCHOLASTIK: Mittelalterliche Philosophie; engstirnige Schulweisheit
SCHOLASTIKER: Lehrer der Scholastik, reiner Verstandesmensch, spitzfindiger Mensch
KAPITALHAUS : Sitzungshaus der Kurie
Wochenspiegel Nr. 14/05, vom 02. April 1971, S. 1-2
Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden,
ein Beitrag zur Stadtgeschichte
Erste Fortsetzung
Das geistig-kirchliche Zentrum im mittelalterlichen Fritzlar lag, wie im ersten Artikel beschrieben wurde, hauptsächlich am heutigen „Dr. Jestädtplatz“. Das weltlich-politische Zentrum haben wir in jener Zeit am Domplatz zu suchen.
Da wäre zuerst mal die ehemalige Kaiserpfalz zu erwähnen. Sie lag nach den Ansichten der historischen Wissenschaftler Dr. Jestädt und Dr. Demandt an der rechten Domplatzseite vom Dom aus gesehen. Erhärtet wird diese Tatsache noch durch das Vorhandensein der ehem. Johanneskirche. Sie stand auf dem Grundstück Nr. 10, dort wo heute Herr Dekan Barth wohnt; Pfalzkapellen waren im Mittelalter meistens dem hl. Johannes geweiht. Hinzu kommt noch die eigenartige Gassenbezeichnung „Meyde-Weg“, welcher parallel zum Domplatz hinter den Häusern der rechten Seite herläuft, Der Name „maior“ wird als Weg zur „Königsvillae“ gedeutet. Prof. Rauch hielt das Gebäude der alten Waage am Kumpf für die Reste der Kaiserpfalz, dessen Rückseite noch heute romanische und frühgotische Bauelemente aufweisen. Möglicherweise könnten alle Recht haben, wenn man sich die Pfalzanlage ähnlich wie in Ingelheim die Bodenforschungen ergeben haben, in einem großen Karree vorstellt. Grabungen würden wahrscheinlich Klärung bringen, Fest steht auf alle Fälle, daß in Fritzlar eine Kaiserpfalz vorhanden war, auf die noch heute verschiedene Urkunden hinweisen. 11 deutsche Kaiser und Könige residierten in Fritzlar. Auch wurden mehrere Reichs- und Kirchentage in Fritzlar abgehalten, bei denen der Kaiser und die Großen des Reiches hier anwesend waren. Von 22 Kaiserbesuchen lassen sich noch die Urkunden von den Kaiserbeschlüssen, welche in Fritzlar getätigt wurden, nachweisen. Die Namen der Kaiser und Könige sind folgende:
Konrad I. König der Franken 911/18, Burgsitz in Fritzlar
König Heinrich I. 919 Königswahl in Fritzlar, erster König der gesamtdeutschen Stämme
Kaiser Otto I. 936/73. (Von Kaisern, die mehrmals in Fritzlar weilten, steht die Regierungszeit dahinter).
Kaiser Otto II. 973/83.
Kaiser Heinrich II. 1002/24, stiftete lo2o das Edelsteinkreuz im Domschatz.
Kaiser Konrad II. 1024/39. Kaiser Heinrich III, 1039/56.
Kaiser Heinrich IV. 1056/1106, als Canossa-Kaiser bekannt.
Rudolf von Schwaben, Gegenkönig, zerstörte Fritzlar 1079.
Kaiser Heinrich V. 1104 und der letzte Kaiser Konrad III, 1145 in Fritzlar.
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, auch auf die große Gerichtsstätte vor dem alten Westportal des Domes hinzuweisen, Hier wurden Urteile von reichs- und weltgeschichtlicher Bedeutung gefällt. So unter anderm der Bann über Kaiser Heinrich V. am 28. 7. 1118 durch den päpstlichen Legaten Kuno von Präneste im Beisein der Großen des Reiches. Gerichtsraum war der freie Platz vor dem Dom, nur ein einfaches Bretterdach schützte vor Regen und Sonne. Man war es von der germanischen Zeit her auch gar nicht anders gewöhnt, Gericht wurde unter freiem Himmel auf den alten Dingstätten gehalten. Deswegen erfolgte auch 919 die Wahl des ersten deutschen Königs, Heinrich I. nicht im Dom, sondern auf der ehem. Dingstätte vor dem Dom. Später, um 1260, wurde an dieser Stelle eine offene Gerichtshalle erbaut, wie es in alten Urkunden hieß ein „Adrium“, gemeint ist damit das heutige Paradies. Die großen Tage der Reichsversammlungen waren aber in Fritzlar vorüber. Das sächsische Kaiserhaus war mit Heinrich V. erloschen, die folgenden Hohenstaufen-Kaiser zogen den warmen Süden Italiens dem kühlen Norden Deutschlands vor, um von dort die Geschicke des Reiches zu leiten, somit diente dann diese Halle kirchlichen Zwecken als Paradies.
Das zweite historische Gebäude, was schon auf eine 900 jährige Geschichte zurückblicken kann, ist unser Rathaus, das älteste Amtsgebäude Deutschlands. In seinen romanischen Anfängen etwa um 1050, war es die Vogtei. Vögte vonFritzlar waren in jener Zeit die Landgrafen von Thüringen, die dort auch ihre Gerichtstätigkeit ausübten, Im 13. Jahrhundert wurde die Vogtei gegenstandslos, deswegen verkaufte Landgraf Konrad 1231 dieses Gebäude dem Kloster Berich, wo es dann 1266 durch zweite Hand von dem Fritzlarer Ratsmann Swineouge zum Zwecke eines Rathauses erworben wurde.
In den folgenden 700 Jahren, wo diese alte Vogtei als Rathaus diente, haben 167 Bürgermeister in ihm amtiert. Romanisch sind noch die beiden Keller und die Eingangsbögen an der Westseite des heutigen Gebäudes.
1442 erhielt das Rathaus sein gotisches Aussehen, etwa so wie es nach der Renovierung von 1964 wiederhergestellt wurde. Im Mittelalter diente die ebenerdige große Rathaushalle an gewissen Wochentagen den Tuchwebern als Verkaufshalle, die Käufer konnten sich an der Fritzlarer-Elle, welche noch heute an der Nordseite des Domes vorhanden ist, von der Richtigkeit der Tuchlänge überzeugen.
An der Westseite des Rathauses führt eine Straße mit dem Namen „Zwischen den Krämen“, sie erhielt diesen Namen von den Krämerläden, die dort seßhaft waren. Eines dieser alten Krämerhäuser ist uns noch in dem Haus Faupel gegenüber dem Rathaus erhalten geblieben. Es kann schon auf ein halbes Jahrtausend zurückblicken, links von der Haustür muß man sich den Verkaufsladen vorstellen, Es wurde einfach die große Fensterlade nach der Straße zu aufgekippt, so war gleich der Verkaufstisch vorhanden, an denen sonntags die Landbevölkerung, wenn sie vom Dom kamen, ihre Einkäufe tätigten. Der Weg an der Ostseite des Rathauses hat den Namen „Spitzengasse“, weil es den spitzen Häuserkomplex vom Rathaus trennt.
Ein weiteres weltliches Gebäude am oberen Ende des Domplatzes war das kurmainzische Amtshaus, später Schule, heute evangelischer Kindergarten und Pfarrheim. Über der unteren Haustür ist noch heute das Mainzer Rad mit dem Kurhut erhalten, Die mainzischen Oberamtmänner und sein stellvertretender Amtmann, waren die ranghöchsten weltlichen Persönlichkeiten in Fritzlar, Oberamtmänner waren außer dem Landgrafen von Hessen, die Grafen von Nassau, von Ysenburg-Büdingen, von Waldeck, von Ziegenhain und andere mehr. Sie weilten nur zeitweilig in Fritzlar. Festen Wohnsitz hatten dagegen die Amtmänner, sie stammten meistens aus dem Uradel. Die Fritzlarer Amtmänner verwalteten den mainzisehen Grundbesitz in Hessen bis zum Eichsfeld, gleichzeitig sind sie als Zivil- und Militär-Gouverneure zu betrachten.
Letzter Amtmann von Fritzlar war Franz Ludwig von Weitershausen. Ein Epitaph mit 64 adligen Wappen dieser Familie befindet sich im Dom in der Seitenkapelle neben dem Eingang zum Kreuzgang, Diese Familie von Weitershausen stiftete auch zwei der noch erhaltenen Wegekreuze, eins in der Fraumünsterstraße und das andere Ecke Hellenweg-Kasseler Straße.
Das Stück Weg vom Amtshaus bis zum Ziegenberg ist die Rittergasse. Dort und am oberen Domplatz wohnten in den restlichen Häusern die ritterlichen Vasallen des Stiftes. Sie waren die Burgmänner des mainzer Erzbischof~, der ja gleichzeitig Stadtherr von Fritzlar war, der den Rittern die mainzischen Besitzungen in Hessen als Lehn überließ.
So sieht man noch am Haus Nr. 14 das Wappen der Burgmannen Familie von Katzmann, 22 solcher ritterlichen Vasallen zähle das Fritzlarer Stift.
Daher kann man heute noch Wappen von den hessischen Rittern: von Wildungen, von Schomberg, von Linsingen, von Gilsa, von Urf, von Elben und andere mehr in Fritzlar finden. Der Roßmarkt hat seinen Namen von den Pferdestallungen, in welchen die Ritter ihre Pferde stehen hatten, Der Weg oberhalb des Amtshauses gehörte mit zu der alten „Bischofsgasse“, er führte zur erzbischöflichen Burg. Dieselbe lag zwischen dem Frauenturm und der noch heutigen Wegebezeichnung „Am Burggraben“, auf dem Gelände am „neuen Gestück“ (eine Bezeichnung für die halbhohe Bastei in der Stadtmauer), wo sich der Schulgarten der St. Wigbert- Kinderpflegerinnenschule befindet. Die alte Burg ist 1229 von den Mannen des Landgrafen Konrad zerstört worden. Den Aufbau einer neuen Burg wußte das Fritzlarer Patriziat und die aufstrebende Bürgerschaft mit viel Geschick zu verhindern. Zumindest wurde der spätere Burgbau keine Zwingburg zum Schaden der Fritzlarer Bürger. Damit wäre also der Dombezirk im wesentlichen beschrieben. Man kann wohl sagen, daß im Mittelalter ein interessantes Völkchcn dort wohnte. Fortsetzen ich in zwangloser Folge dieses Thema mit dem Marktplatzbezirk und sein Wirtschaftsleben.
GLOSSAR
Kaiserpfalz - Kaiserlicher Palast; Hofburg für kaiserliches Hofgericht
Karree - Viereck; Gruppe von vier
Dingstätte - Germanische Volks-, Gerichts- und Heeresversammlung
Gouverneur- Statthalter
Paradies - Portalvorbau an mittelalterlichen Kirchen Epitaph - Grabschrift; Grabmal mit Inschrift
Wochenspiegel Nr. 17/05, vom 23. April 1971, S. 1-2
Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden,
ein Beitrag zur Stadtgeschichte. (Der Marktplatz)
Zweite Fortsetzung
Die Grundrißgestaltung der neuen Stadt Fritzlar des frühen 12. Jahrhunderts gegenüber des alten Kerns um den Dombezirk, zeigt durch die zentrale Lage des Marktplatzes und die allein dadurch bestimmte Linienführung sämtlicher Straßen unwiderleglich, daß es wirtschaftliche Gesichtspunkte gewesen sind, die diese Art der Stadtplanung bedingten. Die Leistungen der ältesten Fritzlarer Kaufmannschaft des 12. bis 15. Jahrhunderts stellten die Führungskräfte des Fritzlarer Wirtschaftslebens. Gleichzeitig war die Einheit von Großkaufleuten und Ratsfamilien, die das Fritzlarer Patriziat bildeten, in der besonderen Gilde der Michaelsbruderschaft vereinigt. Hinzu kam noch die beträchtliche Zahl der verschiedenen Handwerker, welche mit ihren Zünften einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor darstellten.
Nicht die zahlreichen Liegenschaften an Äckern, Wiesen, Gärten und Weinbergen, welche die Fritzlarer Einwohnerschaft im weiten Umkreis zusammenbrachte, also eine vorwiegende landwirtschaftliche Bestätigung, war die Grundlage des Reichtums der führenden Fritzlarer Familien, sondern es war vielmehr ihre Handelstätigkeit und ihr Gewerbefleiß, auf dem ihr Wohlstand beruhte und erst dieser führte dann auch zu einem weit ausgedehnten Güterbesitz.
Fritzlar war nicht nur im Besitz von bestimmten Jahr- und Wochenmärkten, sondern besaß auch einen ständigen Markt. Zu den beiden alten großen Jahrmärkten am 1. Mai und am 10. August kam 1464 noch ein dritter Jahrmarkt im Oktober hinzu. Im Mittelalter erstreckte sich der Einflußbereich des Fritzlarer Marktes über ganz Niederhessen und Waldeck, denn der Gebrauch von Fritzlarer Münze und Maß, welche seine Ausdehnung am sichersten kennzeichnet, war im 15. Jahrhundert für ganz Hessen maßgebend. Seit frühester Zeit wurden durch die Großkaufleute auf den Fritzlarer Märkten die wertvollen Fernhandelsartikel wie kostbare Tuche, Pelze, Seide, Gewürze, Spezereien, Südfrüchte und Weine gehandelt. Zudem war Fritzlar ein hervorragender Handelsplatz für Getreide und Wolle. Die Erzeugnisse von 25 verschiedenen Handwerks- und Gewerbezweigen, die nicht nur für den städtischen Bedarf gearbeitet haben, von denen sich ab Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts 332 Betriebe nachweisen lassen, geben uns noch heute ein anschauliches Bild über die Wirtschaftsmöglichkeiten in unserer Stadt.
Der Fritzlarer Marktplatz mit seinen Geschäftshäusern und Standplätzen war ein einzigartiges Großkaufhaus. Die Michaelsbruderschaft besaß außer ihrem Gildehaus mit dem Türmchen, heute Drogerie Busch, noch zwei Kaufhäuser am Markt, möglicherweise die beiden links und rechts vom Gildehaus. Die heutige Kreissparkasse war früher die Bäckerschirne, wo die Bäcker gemeinsam ihre Waren feilboten. Die Fleischerschirne war im heutigen Zigarrenhaus Thiel und die Fischbank im Hause Metzgerei Krause. Im Lambert'schen Haus war die Fritzlarer Münze, die von den Goldschmieden geführt wurde. 16 Goldschmiedemeister lassen sich für diese Zeit urkundlich in Fritzlar nachweisen. Ihre Erzeugnisse sind außer im Domschatznoch in vielen Museen in Deutschland und darüber hinaus nachweisbar. Die heutige Volksbank war ein Handelshaus der Patrizierfamilie Iwan, die zusammen mit der verschwägerten Patrizierfamilie Terkis schon damals ausgedehnte Geldgeschäfte in bankähnlicher Art tätigten. Das Haus Bäckerei Hetzler war eine der Fritzlarer Brauereien, möglicherweise in Verbindung mit dem Haus Seibel, früher der berühmte Gasthof „Zur Lilie“, erbaut um 1480 von der Patrizierfamilie Iwan. Hessische Fürsten, Landgrafen, Mainzische Räte, adlige Herren und Kaufleute gehörten zu ihren Gästen. Im 30-jährigen Kriege war der Bruder des deutschen Kaisers, Erzherzog Leopold Wilhelm und Fürst Piccolomini Gast, sowie Generalfeldmarschall Graf Tilly, die Generale Graf Goetz, Galls und Isolani weilten mehrmals dort.
Das steinerne Haus Ille, wo heute die Hessische Allgemeine ihre Redaktion hat, war ein Handelshaus der Patrizierfamilic Terkis. Alle übrigen Häuser am Markt waren ebenfalls Geschäftshäuser, hinzu kam noch der Marktplatz mit den offenen Verkaufsständen, in dessen Mitte noch heute der Marktbrunnen mit dem Roland steht, ein Rechtswahrzeichen, Sinnbild der städtischen Banngewalt, des Markt- und Gerichtsbannes.
Wir ersehen aus der damaligen Wirtschaftssituation, daß Fritzlar im Mittelalter eine weit größere Bedeutung als heute hatte, war sie ja bis zur Reformation die Landeshauptstadt von Niederhessen. Diese eingehenden Erkenntnisse des Fritzlarer Wirtschaftslebens verdanken wir den Urkundenforschungen von Dr. K, E. Demandt aus seinen verschiedenen Geschichtswerken.
Folgende Gassen laufen strahlenartig vom Markt zur Stadtmauer: Die „Hundgasse“ weist auf uns die Hundsburg am Haddamartor hin; der Name stammt noch aus dem Germanischen, der Führer einer Hundertschaft war der „Hund“, Die Grebengasse gabelt sich mit der Rosengasse. „Grebengasse“ und Grebenturm haben ihren Namen von den dort wohnhaften Greben, (Grebe = Gemeindevertreter). Der blumige Name „Rosengasse“ mit Rosenturm war im Mittelalter das Eroszentrum; wo von der Stadt das Frauenhaus mit der Meisterin und dem Wirt gehalten wurde, eine Einrichtung großstädtischer Gewohnheiten. Die „Schildergasse“ weist uns auf den für ganz Hessen einmaligen Beruf der Schilderer hin. Unter diesem Kunsthandwerk hat man die heraldischen Arbeiten zu verstehen, wie den Wappenschmuck der ritterlichen Rüstungen, also insbesondere die Ausstattung der Schilde, Helmzierden, Wappenröcke, Pferdedecken und Banner, auch Bronzeguß von Wappentafeln, wie sie noch im Dom erhalten sind. Da die Erzeugnisse der Kunst der Schilderer in Fritzlar allein nicht unterzubringen waren, müssen sie für eine auswärtige Abnehmerschaft gearbeitet haben, und als solche kommt nur der hessische Adel in Frage, dessen enge Beziehungen zur Stadt durch das dortige Stift gegeben waren, da dieses bis in das 14. Jahrhundert nur Herren adeliger Abkunft offenstand.
Naturgemäß ist von diesen vergänglichen Schöpfungen nicht viel erhalten, wenn man nicht die herrlichen ältesten Totenschilde der hessischen Landgrafen in der Elisabethkirche zu Marburg, wo ein solches Handwerk damals nicht nachweisbar ist, als Fritzlarer Arbeiten ansprechen kann.
Am Anfang der Schildergasse zweigt das „Lierloch“ ab (=Lauerloch), Der Name deutet auf einen ehemaligen Mauervorsprung hin. Der Rundgang hinter der Stadtmauer - auch Rondengang genannt - heißt in Fritzlarer Mundart einfach „hinger de mure“. Das Wegestück „am Hochzeitshaus“ weist auf Fritzlars ältestes Bürgerhaus hin; das Gebäude erstreckt sich über zwei Straßen und ist noch heute das größte Fachwerkhaus Hessens. In den Jahren 1580-90 wurde der stattliche Fachwerkbau in reicher Renaissance mit kräftig gezeichneten Gesimsen und steinernem Erdgeschoß erbaut. An dem Treppenturm vor der Westseite ein fein ornamentiertes Portal von „Andreas Herber“, eine bekannte Kunsthandwerkerfamilie aus Kassel. Die Türrahmung enthält im oberen SturZ folgende Zeilen:
DAS.HAUS.STET.IN.GOTTES.HAND.DAS.HOCHZEIT.HAUS.IST.ES.GENAT. Es war in seinen fast 400 Jahren ein Mehrzweckhaus im wahrsten Sinn des Wortes.- als Hochzeitshaus und für Familienfeste erbaut, gefüllt mit Tischen, Stühlen und Schränken sowie Zinn und Leinen und Eßgeschirr. In den Kriegen als Lazarett benutzt und ausgeplündert, dann jahrelang als Husarenkaserne, auch zwischendurch als behelfsmäßiges Rathaus, später die große Bürgerschule und nach dem letzten Kriege Krankenkasse und Behelfswohnungen, heute Heimatmuseum. Die alte Bischofsgasse, heute „St, Wigbert-Straße“ erinnert an den ersten Abt des Fritzlarer Benediktinerklosters, welcher heilig gesprochen wurde und in der Domkrypta sein Hochgrab hat. Eingeschlossen wird der Marktplatzbezirk durch das „Geismartor“ und den „Grauen Turm“, die Kommandostelle der Fritzlarer Warten; als solchen stellt er noch heute den größten Wehrturm Deutschlands dar.
Als Fortsetzung dieser Artikelserie beschreibe ich demnächst den Bezirk an der evangelischen Kirche.
H. J. Heer
Wochenspiegel Nr. 22/05, vom 22. Mai 1971, S. 1-2
Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden - ein Beitrag zur Stadtgeschichte (Stadtteil B)
Dritte Fortsetzung
Fritzlar, insbesondere der alte Stadtteil B zwischen der heutigen ev. Stadtkirche und dem ehemaligen Haddamartor, liegt an einer Hauptstraße, und zwar an der alten Völkerstraße von Kopenhagen nach Sizilien, die heutige Bundesstraße 3.
Vom Marktplatz an aufwärts hieß die Straße früher "Haddamargasse", heute (ab etwa 1948) Kasseler Straße und abwärts die °Werkelgasse", heute Gießener Straße, Vom Werkeltor aus zweigte früher eine Straße am Exerzierplatz vorbei nach Werkel.
Wie Gießen zu der Straßenehre kam, habe ich nicht feststellen können -Marburger oder Frankfurter Straße wäre da sinnvoller gewesen- der Volksmund nennt sie heute auch noch die Poststraße.
In diesen beiden alten Hauptgassen haben wir uns zum großen Teil die Wohn- und Lagerhäuser des Fritzlarer Patriziats zu denken, Der Reichtum dieser Großhandelsfamilien spiegelt sich noch heute in den alten Stein- und Fachwerkhäusern wieder, Ihre Handelstätigkeit erstreckte sich über ganz Westdeutschland bis nach Flandern, gleichzeitig waren sie die Bankiers nicht nur für die Fritzlarer Einwohner, sondern auch für die Landgrafen und den hessischen Adel,
28 Familien, die durch Generationen urkundlich bekannt sind, prägten die gehobene Schicht des bürgerlichen Bildes unserer Stadt, Es waren die Familien. Knorre und Grebe, Schindeleib und Pape.9 die Moischeidt, Müller und Bode, die Katzmann, Iwan und Wrede, vom Friedhof, Terkis und Same, und die von Felsberg, von Homberg, von Streithausen von Treysa und von Borken, die von Heimarshausen, von Kirchhain, von Waldeck, von Holzheim und von Ritte und schließlich die Familien von Melsungen, von Kirchberg, von Lemgo, von Sachsenhausen und von Beverungen.
Aus ihnen heraus ragte wiederum eine besondere Patrizierfamilie, die '"Terkis". Ihre Blütezeit liegt zwischen 1290 bis 1450~ Fünf von den noch erhaltenen elf mittelalterlichen steinernen Wohnhäusern in Fritzlar waren in ihrem Besitz; denn steinerne Bürgerbauten dokumentierten im Gegensatz zu der Masse der Fachwerkhäuser besonderen Reichtum.
Dr. Demandt schreibt über diese Familie: "Überblicken wir den Fritzlarer Häuser- und Zinsbesitz dieser Familie, ihre zahlreichen Äcker, Wiesen, Gärten, Weinberge und Weidenkulturen in der Fritzlarer Gemarkung und ihre Güter und Renten in Holzheim, Geismar, Werkel, Gudensberg, Uttershausen, Dorla, Zennern und Todenhausen und nehmen wir ihre enge Versippung mit den übrigen Fritzlarer Patrizierfamilien, vor allem aber ihre beherrschende Stellung im Fritzlarer Rat hinzu, dann ist kein Zweifel möglich, daß wir in der Familie Terkis die führende Fritzlarer Familie des 14. Jahrunderts zu sehen haben. Fast 150 Jahre gehörten ihre Männer dem Rat an, nahezu 50 Jahre waren sie mehrfach durch zwei, drei ja vier Angehörige gleichzeitig im Rat vertreten, was sich sonst für keine andere Familie dieser Zeit nachweisen läßt, und 110 Jahre lang ist ihre ständige Wiederkehr auf dem Fritzlarer Bürgermeistersitz das eindringlichste Zeugnis für die Befähigung, das Ansehen und das Vertrauen, mit der diese Familie vor allen Fritzlarer Geschlechtern des 14. Jahrhunderts ausgezeichnet war. Bei den schweren Vorherrschaftskämpfen zwischen Adolf und Johann von Mainz und Landgraf Hermann von Hessen, erhielt diese Familie so schwere Besitzstörungen und kamen in die Gewalt des Landgrafen, von dem sie sich in den Jahren von 1402 bis 1403 durch tausende von Goldgulden in vier kurzfristigen Terminen freikaufen mußten, welches nach der heutigen Währung Millionenbeträge wären, denn in damaliger Zeit kostete ein mittleres Wohnhaus etwa 100 Goldgulden".
Ich verzeichne diesen Vorgang nur, damit man sich ein besseres Bild von dem mittelalterlichen Wirtschaftsleben in Fritzlar machen kann. Heute wüßte ich niemanden, der über derartiges Vermögen in Fritzlar verfügte.
Gehen wir nun den Gassen und Häusern entlang, da wäre zuerst das schönste der Fritzlarer Stadttore, das "Haddamartor", zu nennen. Es hatte einen quadratischen Torturm mit vier kleinen Türmchen, eine doppelte spitzbogige Durchfahrt, nach der Stadtseite hin befand sich ein Relief mit Christus am Kreuz nebst Maria und Johannes und nach außen war das noch jetzt im Kreuzgang des Domes erhaltene Relief des Stadtpatrons St. Martin mit den ältesten Fritzlarer Stadtwappen aus dem 14. Jahrhundert. Leider wurde dieses schöne Stadttor im Rahmen der Modernisierung im Jahre 1838 abgebrochen. Rechts vom Haddamartor lag der Hardehäuser Hof, eine Zisterzienser-Niederlassung des Klosters Hardehausen bei Warburg, heute das Haus "Hessischer Hof" im Besitz der Familie Hauptmann. Es reicht bis in das 12. Jahrhundert zurück und bestand bis 1775; romanische und gotische Bauteile sind noch heute an der Rückwand des Hauses zu erkennen. Es folgen nun rechts und links in der Haddamargasse die Fachwerkhäuser. Hervorzuheben sind die beiden gotischen Steinbauten, die Stammhäuser der Familien Iwan und Terkis, heute Haus Burchart und van der Mispel. Um 1300 erbaut sind sie noch nach fast 700 Jahren eine Sehenswürdigkeit. Leider hat man auch hier 1902 ein drittes Steinhaus aus derselben Zeit, zwischen dem Haus Kelber und der Adler-Apotheke abgebrochen; die Stelle wirkt noch immer wie eine häßliche Zahnlücke. Von den stattlichen Fachwerkhäusern ist besonders das Haus, in welchem sich heute das Herrenmodegeschäft Lambert befindet, zu erwähnen. Es wurde 1631, mitten im 30jährigen Kriege, von den Eheleuten Jost und Eila Winter erbaut. Also in einer Zeit, in der ringsum in unserem Hessenland fast alle Städte in Schutt und Asche lagen. Zu erklären ist diese Tatsache nur durch die außerordentliche wehrhafte Stadtbefestigung.
Zu den Wohnhäusern gehörten auch die rückseitigen großen Lagerhäuser, wie sie in der Hundgasse noch zu sehen sind. Welche geschäftlichen Transaktionen noch im Jahre 1600 in Fritzlar möglich waren, zeigt uns ein Wolleverkauf des Fritzlarer Händlers Heinemann an die Frankfurter Großwollhandlung Soreau über 1500 Zentner Wolle, Die sperrige Wolle ergäbe noch heute ca. 8000 Zentnersäcke voll, die eine Güterzugsendung ausmachen würden; zu damaliger Zeit umfaßte sie etwa 60 Planwagen.
Die heutige Martinsgasse war früher die "Judengasse", welche zusammen mit dem Jordan das Judenwohnviertel war, Juden lassen sich schon seit 1315 in Fritzlar nachweisen. 1935 hatte die Stadt Fritzlar noch 130 jüdische Einwohner. Gehen wir nur vom Markt zur Werkelgasse; hier zweigt links die "Vitsgasse" zur alten Judengasse ab. Ihren Namen verdankt sie wohl dem Vitusaltar in der Nikolauskirche, auf welchen sie zustößt. Das steinerne Wohnhaus, heute Gangolf Dietrich, ist etwa um 1320 von der Familie Terkis erbaut, hatte einen gotischen Staffelgiebel wie noch auf der Stadtansicht von 1572 erkennbar ist und erhielt wohl 1590 sein heutiges Gesicht, wie die Wetterfahne zeigt und ward früher der "Herrenhof" genannt, Die folgende Gasse ist die "Behnebach", was soviel wie Grenzbach besagt, wohl früher ein Bach oder eine Quelle, welche die zwei alten Brunnen auf dem heutigen Posthof mit Wasser versorgten. Die Gastwirtschaft Siebert ist auch eines der steinernen Häuser aus dem 14, Jahrhundert. Als letzte Gasse vor dem Werkeltor zum Jordan ist die "Brüdergasse" (zu nennen); ihren Namen hat sie von den Franziskaner-Brüdern, die 1237 in dieser Gasse und an der Stadtmauer ihr Kloster mit Kirche errichteten und (welche) seit dem Jahre 1824 evangelische Stadtkirche wurde; ein Meisterwerk der hessischen Gotik. Über dem alten Eingang zum Kloster befindet sich noch heute eine Franziskaner-Figur mit einem Kruzifix in den Armen aus dem Jahre 1690, Aus gleicher Zeit ist das Haus schräg gegenüber mit der schönen Barockhaustür, welches die städtische Lateinschule St. Bonaventura war und von den Franziskaner-Brüdern geführt wurde.
Die Stadtmauer mit dem Jordansturm umschließt noch heute diesen alten Fritzlarer Stadtteil B. Als letzten Beitrag dieser Artikelserie werde ich demnächst den Stadtteil C mit der Neustadt beschreiben.
H.J. Heer
Wochenspiegel Nr. 45/05, vom 05. November 1971, S. 1-2
Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden - ein Beitrag zur Stadtgeschichte (Stadtteil C)
Vierte Fortsetzung
Um den interessierten Lesern dieses Thema in das Gedächtnis zurückzurufen, verweise ich auf die vorausgegangenen Aufsätze im diesjährigen Wochenspiegel Nr. 12, 14, 17, und 22.
Bevor ich zu der Beschreibung der Gassennamen des Stadtteils C innerhalb der Altstadt komme, muß ich den Lesern noch den überwiegenden Teil der Bürgerschaft im mittelalterlichen Fritzlar vorstellen. In den vorausgegangenen Aufsätzen hatte ich Ihnen drei besondere Einwohnerklassen unserer Stadt beschrieben; es waren die Stiftsherren, - sie stammten meistens aus den mitteldeutschen Räumen und waren größtenteils von adliger Geburt; die Stiftsvasallen, - sie kamen aus dem hessischen Landadel und das Fritzlarer Patriziat, - sie waren zum Teil Fritzlarer Ureinwohner bis auf jene, welche als Hausnamen die Namen ihrer ehemaligen Wohnorte angenommen hatten.
Es war aber in der Vergangenheit keinesfalls so gewesen, daß die gehobene Klassenschicht in unserer Stadt die Masse der bürgerlichen Einwohner beherrschte. Natürlich gab es da, wo Klassenunterschiede vorhanden waren, auch Reibereien, aber die Stadtgemeinde hat es in ihrer Vertretung durch das "Gemeinde Wort" immer verstanden, ihre Belange beim Stadtherrn, dem jeweiligen Erzbischof von Mainz, durchzusetzen.
Die allgemeine Bürgerschaft bestand ausschließlich aus Handwerkern und Gewerbetreibenden. Bäuerliche Betätigung wie sie uns in kleineren Städten, besonders seit den Zusammenbrüchen des 30-jährigen Krieges häufig begegnet, gab es im mittelalterlichen Fritzlar nicht. Zwar gehörte zum städtischen Bereich eine große Feldmark mit Wald, Äckern, Weinbergen und Gärten. Von diesen bearbeiteten die Fritzlarer Bürger selbst jedoch nur ihre eigenen, unmittelbar um die Stadt herumliegenden Gärten und ihre Weinberge, die sich an den Hängen des Ederufers entlang zogen. Die Äcker der Feldmark wurden in der Regel von der Bevölkerung der umliegenden Dörfer bearbeitet, denen sie in Erbpacht oder in einer anderen Form der bäuerlichen Landnutzung zur Bewirtschaftung übergeben waren. Im ganzen gesehen ein Einwohnerbild, wie wir es noch heute in den größeren Städten vorfinden.
Den Stadtteil C beginne ich mit der heutigen Postecke. Früher stand auf diesem Gelände die Nikolauskirche, die etwa im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Im 17. Jahrhundert diente diese Kirche als Stadtarchiv, an deren Turm die älteste städtische Schlaguhr angebracht war.
1878 besichtigte und kaufte der erste reichsdeutsche General-Postdirektor Dr. von Stephan, Gründer des Postwesens, persönlich in Fritzlar das verwaiste Klostergelände mit der Nikolauskirche für die Deutsche Reichspost, auf welchem dann 1882 das heutige Postgebäude errichtet wurde.
Rechts an der Post vorbei, läuft die alte "Clobesgasse" (Clobes = Klaus) heute "Nikolausstraße", die ihren Namen der ehem. Nikolauskirche verdankt. Die zweite Brauerei in Fritzlar befand sich früher in dieser Gasse, im Hause der Konditorei Heer. Auf halbem Wege in der Nikolausstraße zweigt rechts diee heutige "Judengasse" ab; sie kam zu dem Namen, weil seit 1896 die Judenschule und die Synagoge an ihr lag.
Etwas weiter abwärts biegt links die "Hintergasse" ein, früher die "Zansgasse" genannt - diese Gasse umschließt das Wohnviertel wie eine Zange.
Gehen wir zurück zur Postecke in Richtung "Gießener Straße"; da ist von den Häusern der rechten Straßenseite das heutige Hotel Kaiserpfalz von Interesse. Es wurde im 14. Jahrhundert als steinernes Haus mit gotischem Fachwerkgiebel durch die Patrizierfamilie von Homberg erbaut (und) befand sich im 15. Jahrhundert im Besitz der Patrizierfamilie von Katzmann. 1719 waren in diesem Hause die Gründungsanfänge des heutigen Ursulinenklosters, ab 1720 wurde dieses Haus die "Thurn- und Taxi´sche" Posthalterei. Posthalter war durch mehrere Generationen die Familie Brotzmann. Um 1900 eröffnete die Familie Bringmann in diesem Hause das Hotel "Englischer Hof", welches seit 1918 den Namen "Hotel Kaiserpfalz" erhielt.
Die nahe am Haus vorbeiführende Flehmengasse wird bereits schon 1286 als "platea flemyrigorum" erwähnt; sie hat ihren Namen von den eingewanderten Wollwebern aus der Stadt Breda in Flamen erhalten. Gleichfalls befand sich seit dem 14. Jahrhundert in der Flehmengasse eine Ordensniederlassung der "Beghinnen" - eine Schwesterngemeinschaft für häusliche Krankenpflege; ihr Klosterhaus war das steinerne Gebäude, wo sich heute die Büroräume der Großhandlung Schmitt und Durstewitz befinden. Neben dem Haus befand sich noch vor Jahren eine große gotische Torausfahrt mit Pförtchen, welches ehemals zu dem großen steinernen Lagerhaus der Deutschordensgesellschaft gehörte - heute Lagerhaus der vorerwähnten Firma.
Die Hintergasse verbindet die Flehmengasse mit der Nikolausstraße. Von ihr zweigt noch ein kleines Gäßchen ab mit der Benennung "Seidener Beutel". Darin haben früher die Beutelmacher (Handtaschenmacher) gewohnt. Auf der Stadtansicht von 1572 sieht man noch eine Fritzlarer Bürgerin, die stolz einen "Seidenen Beutel" in der Hand hält. Auch der alte Fritzlarer Berufs- und Hausname "Schleiermacher" ist in diesem ehemaligen Textilviertel als Bewohner zu finden.
Alle drei Gassen münden in die "Fraumünstergasse" ein. Sie hat ihren Namen von der Fraumünsterkirche, welche vor dem Münstertor - Richtung "Roter Rain" liegt. Die Fraumünsterkirche ist als älteste Kirche von Fritzlar erhalten geblieben. Sie reicht mit ihren Bauanfängen bis in die karolinische Zeit zurück (8. Jahrhundert). Sie wurde wahrscheinlich von den bonifatianischen Benediktinern erbaut, welche solche abgelegenen Kirchlein zur inneren Besinnung errichteten und sie meistens der Gottesmutter weihten.
In der Münstergasse befand sich am Münstertor der ehemalige "Deutsche Ordenshof'. Auf der linken unteren Straßenseite in der langgestreckten Mauer ist heute noch eine große gotische Toreinfahrt mit dem darüber befindlichen Wappen des Landkomturs "Johann von Rehn" aus dem Jahre 1559 und ein Seitenpförtchen mit dem Deutsch-Ordenskreuz vorhanden. Dahinter liegt der große Barockbau der ehemaligen Deutschordens-Komturei Fritzlar, erbaut im Auftrage des Grafen Franz von Schönborn 1720.
Vor der alten Stadtmauer zwischen dem Münstertor und dem Werkeltor befindet sich Fritzlars erster Friedhof außerhalb der Stadt; er wurde bereits 1537 angelegt und ist noch heute Beerdigungsstätte.
Geht man vom Münstertor rechts hinter der Mauer den alten Rondengang entlang, kommt man zum Regilturm, wo sich auch früher das Regiltor befand. Es erhielt seinen Namen durch den vorgebauten Mauerriegel auch "regile" genannt, wie die alte Bezeichnung noch heute lautet.
Vom Regilgäßchen gelangt man in die "Spitalgasse"; in ihr befand sich eines der ältesten Spitalgebäude, welches erst 1969 abgebrochen wurde und auf dessen Gelände heute ein Bungalow erstand.
In diesem Zusammenhang wollen wir auch gleich einen kurzen Blick auf die sozialen Fürsorgemaßnahmen unserer Stadt werfen. Sie war zum Teil in geradezu moderner Weise geregelt. Fritzlar hatte mit die ersten und meisten Ärzte von Hessen. Schon 1132 wird uns der älteste Fritzlarer Arzt "Heinrich" genannt; ebenso war der erste studierte Bürgermeister einer hessischen Stadt der 1279 genannte Fritzlarer Magister "Konrad" , zugleich Arzt unserer Stadt. Der erste bekannte Leibarzt der Landgrafen von Hessen "Johannes" stammte ebenfalls aus Fritzlar. Studieren konnten diese damals nur auf den europäischen Universitäten wie z. B. Paris, Bologna oder Padua, denn deutsche Universitäten gab es erst seit dem 14. Jahrhundert. Neben diesen Ärzten waren noch eine Anzahl von sogenannten Chirurgen oder Badern vorhanden, welche einfache ärztliche Verrichtungen ausübten. Drei städtische Hebammen lassen sich schon im 15. Jahrhundert nachweisen. Krankenhäuser waren außer den schon genannten die ehem. Klöster sowie das städtische Heilig-Geist-Hospital an der alten Steinbrücke. Dort befanden sich auch die Isolierstationen mit ihren Cholera- und Leprahäusern.
Die Spitalsgasse fand durch das Steingossentor seinen Abschluß, welches die Altstadt mit der Neustadt verbindet. Die Beschreibung der Neustadt wird der nächste und letzte Artikel dieser Serie über Fritzlars Gassen- und Straßennamen sein.
H. J. Heer
Wochenspiegel Nr. 50/05, vom 10. Dezember 1971, S. 1-2
UNSERE STADT, IN DER WIR LEBEN
Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden Ein Beitrag zur Stadtgeschichte. (Die Neustadt)
Die Neustadt von Fritzlar, im Mittelalter auch die „Freiheit“ genannt, ist garnicht mehr so ganz neu, denn mit einem Alter voll ca. 850 Jahren ist sie immerhin schon 100 Jahre älter als z. B, die ehem. Reichshauptstadt Berlin. Ihre Anfänge wurden durch den Bau eines Hospitals um 1140 von dem Propst Bruno von Weißenstein begründet, welches dann später durch ein Augustinerinnen-Kloster mit Kirche erweitert wurde. Um nun diesen neuen Stadtteil für Siedler interessant zu machen, wurde auch in Fritzlar, wie in vielen anderen Städten, dem Neubürger gewisse steuerliche Freiheiten gewährt, wovon der Name die „Freiheit“ stammt. Großen Zuwachs an Neubürgern erhielt dieser Stadtteil um 1400 aus dem zerstörten Holzheim, von dem auch die durchgehende Straße in der Neustadt ihren Namen bekam, die „Holzgasse“", heute die Neustädter Straße genannt, Zuerst mit einfachen Mauern umgeben, erhielt sie etwa um 1580 eine starke Befestigungsanlage, wie die alte Stadtansicht auf der Kopfleiste des Wochenspiegels zeigt.
Von der Stadt her konnte die Neustadt durch das Steingossen- und Fleckeuborntor betreten werden und durch das Winter- und Bleichentor verlies man sie um in die Ederau zn gelangen.
Beginnen wir den geschichtlichen Rundgang am Steingossentor. Es befand sich an der noch heute imposantesten Stadtbefestigungsstelle in der Neustädter-Straße, wo sich die Treppen zum Bad und die Treppen zum Zuckmantel fast gegenüber liegen. Er hatte seinen Namen von der alten Steingosse, welche unterhalb der Straße neben der Treppe die Abwässer der Altstadt von der Neustadt ableitete. Der links hinter der Mauer liegende Garten hieß die Bärengrube und rechts beginnt der große Amberg, früher mit Wein bewachsen.
Geht man die Treppen zum Bad herunter, so sieht man in dem ersten Mauersturz der Altstadtmauer zwei bearbeitete Steine eingemauert, ein Löwe und ein Menschenköpfchen.
Was sind dies nun für Steine, welches die Mauerhandwerker aus Achtung vor den bearbeiteten Stein dort einsetzten? Für uns Kinder hatte das früher eine ganz einfache Lösung, da hat eben ein Löwe ein Kind aufgefressen. Der Löwe im Renaissancestil stammt wohl aus dem 15, oder 16. Jahrhundert, aber mit dem Köpfchen war es hon schwieriger. Prof. O. Menghin, einer der bedeutensten Frühgeschichtswissenschaftler, dem ich dieses Köpfchen mal zeigte, hält es für keltisch also von einem Volksstamm aus der Zeit etwa 400 vor Christi. Verwundern braucht uns dies nicht, hat man doch in den letzten 20 Jahren Fundstücke von allen Vorgeschichtskulturen bis hin zur ältesten Steinzeit (150000 v. Chr.) in und um Fritzlar gefunden, welche im Vorgeschichtsmuseum im Hochzeitshaus ihre Ausstellung fanden. Trotzdem kann man wohl mit Berechtigung sagen, Fritzlar steckt voller Merkwürdigkeiten.
Die Treppe selbst führt zum Steingossenturm, oder wie er auch noch genannt wird „Turm zum Bad“. Bei ihm entspringt der „Steingossenbrunnen“, dessen Wasser früher zum „Bürgerbad“ benutzt wurde, welches sich in dem heutigen Häuschen Arend befand. Geht man dem Gäßchen an diesem Hause abwärts und dann gleich rechts dem Seitengäßchen entlang, so kommt man zum Bonifatiusbrunnen, wo früher auch eine Bonifatiuskapelle stand, dessen Wasser das zweite Fritzlarer Bad, das „Stiftsherrenbad“, speiste. Gebadet wurde in grossen Zubern (Holzbottiche), dabei wurde gegessen und getrunken, gespielt und geliebt. Die Badstuben waren dadurch lukrative Steuereinnahmequellen der Stadt, welche wegen der Franzosenkrankheit (Syphilis), wie überall in Europa im 16. Jahrhundert ihr Ende fand. Erst das 20. Jahrhundert machte das Baden in allen Arten wieder volkstümlich.
Die Treppen hinter der Mauer abwärts vom Steingossenturm führt zum Bleichenturm und ehemaligen Bleichentor, wie schon der Name besagt, zu den städtischen Bleichen. Der Weg innerhalb dieser Neustadtbefestigung vom Bleichentor zur Klostermühle heißt „Das goldene Loch“. Hier wohnten ehemals in den kleinen Häusern die Goldwäscher, denn Gold wurde noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Eder gewaschen. Man muß mit Recht annehmen, daß die Goldschmiedearbeiten des Fritzlarer Domschatzes aus Fritzlarer Edergold entstanden sind.
Die Klostermühle, wovon der angrenzende Mühlenberg seinen Namen hat, gehörte mit dem dabei liegenden Klostergut zum Ursulinenkloster. Von der Südseite her ist der barocke Internatsbau mit der älteren gotischen Katharinenkirche in seiner ganzen Größe und Schönheit zu sehen. Auf dem verwaisten Gelände des ehem. Augustinerinnen-Klosters wurde in den Jahren von 1713-19 das heutige Ursulinen-Kloster erbaut. Die Gründerinnen kamen 1711 vom Mutterkloster der Ursulinerinnen aus Metz, es waren die Schwestern: Augustine Gräfin d' Aspremont, Magdalene Marquise von Valombre und Bernadine Baronesse von Löwenstein. Ihre hohe adlige Herkunft öffnete ihnen leichter Tor und Tür zwecks Gründung eines Mädchen-Pensionates. In großherziger Weise unterstützte sie Landgraf Karl von Hessen, desgleichen auch sein Sohn Friedrich I. der spätere König von Schweden, der ihnen eine Glocke und eine Turmuhr schenkte. Ebenso fanden sie an dem Grafen von Waldeck einen hervorragenden Wohltäter. Auch der Mainzer Kurfürst Franz von Schönborn zeigte ihnen sein Wohlwollen und seine Unterstützung. So gedieh also das Werk.
Im Jahre 1712 traten schon die ersten deutschen Mädchen ins Pensionat ein. Es waren die 9-jährige Tochter des kurpfälzischen Gesandten von Sickingen, die 9-jährige Komtesse von Königsfeld und die 12-jährige Baronesse von Ingelheim.
Rasch mehrte sich die Zahl der Schülerinnen, so daß die Ursulinen an den Neubau des Klosters denken konnten. Der Baumeister des hessischen Landgrafen Garniery, der Erbauer der Herkulesanlagen mit dem Park Wilhelmshöhe, der ihnen ebenfalls seine Tochter zur Erziehung übergeben hatte, erbot sich, die Pläne auszuarbeiten und konnte diese auf seiner Romreise Papst Clemens XI. vorlegen, der sie segnete und fortan der hohe Gönner des Klosters wurde. Er nahm es in seinem besonderen Schutz und betraute die Kardinäle Fabrony und Sacripante, die er in besonderen Auftrag nach Deutschland sandte, sich des Klosters anzunehmen.
Am 5. Aug. 1713 wurde der Grundstein zum neuen Kloster gelegt. Beim Bau erwies sich als großmütiger Helfer Fürstabt Adalbert von Schleifras in Fulda, der Erbauer des Fuldaer Domes, dessen Nichte sich unter den Schülerinnen in Fritzlar befand. Er sandte den Ursulinen seinen eigenen Baumeister Meinwolf. Am 8. Mai 1719 war der Bau soweit gediehen, daß die Ursulinen mit den Zöglingen Einzug halten konnten.
Der Klosterbezirk, zu dem ein großer Garten gehörte, wurde von einer festen Mauer umgeben. Die Anlegung des Gartens besorgte der Generalsgarteninspektor des hessischen Landgrafen Wunsdorf, der evangelisch war, aber zwei Töchter den Ursulinen zur Erziehung übergeben hatte. Unter seiner kunstfertigen Anweisung entstand am Bergeshang ein herrlicher Garten mit Terrassen, Lauben und Laubengängen, Kaskaden und Springbrunnen, der später das Entzücken der Bettina von Brentano hervorrief, die vier Jahre mit ihren drei Schwestern bei den Ursulinen verbrachte und darüber in Briefen an Goethe berichtete. (Sie sind bekannt in der deutschen Literatur unter dem Namen „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde“). Sie schrieb in ihrer romantischen Art: „In den hängenden Gärten der Semiramis bin ich erzogen worden, ich glattes, braunes, feingegliedertes Reheben.“
In weiterer Folge beschreibt sie dann die Schönheit der Gartenanlage des Fritzlarer Ursulinen-Klosters. Die Tätigkeit der Ursulinen bestand zunächst in der Erziehung von Töchtern adeliger Familien, die sich im Pensionat, abgesehen von der französischen Sprache, nur vornehme Lebensart aneigneten. Aber schon im Jahre 1719 begannen die Nonnen gleichzeitig mit dem Schulunterricht für die Fritzlarer Mädchen, wie es früher so schön hieß „de mairenschule“. Generationen von tüchtigen Frauen sind in den vergangenen 260 Jahren aus der Schule des Ursulinen-Klosters hervorgegangen, trotzdem sie zweimal geschlossen wurde, im Kulturkampf 1871 und bei den Nazis 1938, steht sie heute wieder in voller Blüte. In diesem Jahr konnten die Ursulinen ihr neues Schulzentrum einweihen, mit einem Fassungsvermögen von ca. 300 Schülern und einem eigenen Hallenschwimmbad,
Es ist aber keinesfalls so, daß ein derartiger Schulaufstieg nur im 18. Jahrhundert möglich wäre, auch in unserer Zeit haben die Ursulinen bewiesen, mit ihrer Tochtergründung in Lima _ der Hauptstadt Perus, ein noch größeres Schulzentrum aus dem Nichts zu erbauen.
1935 fuhren zwei Fritzlarer Ursulinerinnen mit kleinem Gepäck und großem Gottvertrauen zwecks Gründung einer neuen Heimstatt für ihr Kloster, falls sie in Deutschland nie mehr Schule halten durften, nach Lima in Peru. Auch in diesem Lande konnten sie die Familien mit ihrem Schulorden überzeugen, so daß sie schon 1949 ein neues großes Schulzentrum für über 1000 Schüler mit Internats-Kloster- und Kollegkirche einweihten. Dabei waren zugegen: der Apostolische Nuntius, der Staatspräsident von Peru mit Gemahlin, der Erzbischof von Lima und viele andere hohe Würdenträger des Staates und der Stadt. Man sieht daraus, Ideen und Glauben an einer guten Sache sind noch immer mit Erfolg gekrönt, wobei sich sogar die sogenannten Großen dieser Welt mit einspannen lassen.
Geht man vom Fritzlarer Ursulinen-Kloster die Neustädter Straße abwärts, gelangt man zum Winterturm und ehemaligen Wintertor. Der Name ist leider einer Wortsinnverwechselung zum Opfer gefallen, es müßte heißen Winzertor und Winzerturm. Sie hatten diesen Namen wegen der vinitores = Winzer und 1390 heißt es urkundlich „Wyndor“ oder auf Fritzlarer Platt das „Wingertor“. Solange es noch Winzer und Weinberge in Fritzlar gab, war jedem der Sinn des Wortes klar, erst nachdem7-jährigen Kriege 1763, wo die Weinberge zerstört wurden und in Vergessenheit gerieten, hat später bei der amtlichen Benennung das Wort „winger“ zu den Namen „Winter“ geführt, trotzdem es bei seiner Südwestlage keine Winterseite ist
Das zweite Zugangstor der Neustadt war das Fleckenborntor, welches vom Domplatz her begangen wurde. Es befindet sich, auf halber Höhe der Ziegenbergtreppchen, wo der Fleckenbornweg abzweigt. Unterhalb dieses Weges am Amberg war früher der große Fleckenbrunnen, der fast die ganze Stadt mit Trinkwasser versorgte und dessen Wasser durch die sogenannte „Wasserkunst“ über den Kump am Domplatz in die Stadt verteilt wurde.
Heute nutzen die Ursulinen diese ertragreiche Quelle für ihr Heilbad. Aber auch die Stadt hätte die Möglichkeit mit der Quelle am Steingossenturm im Walter'schen Berg ein Hallenbad mit Wasser zu versorgen.
Damit wäre die Artikelserie über Fritzlars Gassen-und Strassennamen beendet. Die Beschreibungen waren mir nur möglich aus dem reichen Geschichtsmaterial unserer Stadt, dabei sind es nicht mal die großen abgeschlossenen Geschichtswerke, sondern die vielen kleinen Spezialforschungen in den weit verstreuten Aufsätzen, die uns ein Geschichtsbild übermitteln.
H.J. HEER
Wochenspiegel Nr. 12/05, vom 03. März 1972, S. 1-2
UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN
In der Ausgabe Nr. 1/1972 HESSISCHER GEBIRGSBOTE, Zeitschrift des Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatvereins im Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e.V. in Melsungen, erschien der Artikel
DAS HOCHZEITSHAUS IN FRITZLAR UND SEIN MUSEUM
Mit Genehmigung des Verfassers und ersten Vorsitzenden, Herrn Bibl. Oberinspektor Eduard B R A U N S, Kassel, Breitscheidstraße 70, wird dieser Artikel nachstehend im Wortlaut veröffentlicht. Wir finden ihn auch deshalb, sehr interessant, weil die „Ur- und frühgeschichtlichen Sammlungen“ im Museum näher beschrieben worden sind.
Unter den weltlichen Gebäuden der Kreisstadt Fritzlar fällt außer dem Rathaus besonders das stattliche Hochzeitshaus in der Geismargasse, auch „Straße am Hochzeitshaus“ genannt, auf, in welchem sich heute das Museum „Ur- und frühgeschichtliche Sammlungen“ befindet, dessen Träger der gleichnamige Verein in Fritzlar ist.
Der einst vom Erzbischof von Mainz der Stadt Fritzlar zur Erbauung des Hochzeitshauses verkaufte Grund und Boden bildete mit den darauf stehenden Gebäuden den sogenannten Hainer Hof. Die Besitzung war von dem Zisterzienserklostei Haina im 13. Jahrhundert erworben und mit einem Klostervogt besetzt worden, der die dem Kloster in Fritzlar und Umgebung durch Kauf und Stiftung zustehende Frucht- und Geldgefälle vereinnahmte und verrechnete. Häufig stiegen hier der Abt und die Mönche bei ihrem Aufenthalt in der Stadt ab. Deshalb besaß das Haus auch eine Kapelle. Einige Baureste der alten Klostervogtei sind in dem Neubau erhalten geblieben.
In dem Hainer Hof wurde lange Zeit die von dem 1314 verstorbenen Kantor Hermann von Grune mit Zustimmung von Schöffen und Rat der Stadt gemachte Brotstiftung für die Armen ausgeteilt. Er hatte die Verteilung der Spenden den „Brüdern grawen ordens in ihrem hobe gelegen in der statt Fritzlar in der straße, dy da heissit die Geysmargasse“ übertragen.
Als das Kloster Haina in der Reformationszeit säkularisiert wurde und durch den Verzicht des Abts Johann Falckenberg mit anderen Hainaer Gütern auch der Hainer Hof in Fritzlar an den Landgrafen Philipp gefallen war, trat er diesen mit den zugehörigen Ländereien an die junge Universität Marburg ab. Später überließ er den Hof, jedoch ohne die Güter, wieder dem Erzbischof von Mainz, welcher denselben 1578 an die Stadt Fritzlar verkaufte. Er knüpfte daran die Bedingung, daß diese das baufällig gewordene Gebäude abbrechen und ein neues errichten mußte.
Es sollte lediglich zur Feier bürgerlicher Feste, z. B. der Hochzeiten und Kindtaufen, dienen. In einem Memorialbuch der Stadt Fritzlar erfährt man folgende Nachricht, die 1681 im Knopf auf dem Giebel des Hochzeitshauses bei der Reparatur des Daches gefunden worden sein soll: „1578 die 4. Augusti hat der hochwürdigst fürst herr Daniel Erzbischof zu Maintz diesen hof und baufällige behausung zur erbauung eines Hochzeitshauses bürgermeister, rath und gemeinde dieser stadt Fritzlar gnädigst und umb vierhundert gulten batzen erblich zukommen lassen. Welche behausung folgender jahr - achtzig und achtzig ein - neue erbaut und daran gewendet bis daß mans ins tach und leimen bracht ahn die dreytausend dreyhundert thlr.; jeder thlr. zu 31 alb. Gerechnet“. Schließlich heißt es in der Quelle noch: „Johannes Ostheimius scriba civitatis Fridslarie juratus scripsit Non. 7 bris (5. September) anno post christum natum 1581“, wodurch festgestellt wird, daß der Neubau in zwei Jahren vollendet war.
Der große, sehr geräumige Bau hatte sein eigenes Hausgerät, feines Leinenzeug und ein reiches Inventar an Zinn-, Kupfer- und anderem Küchengeschirr. Jedes Ehepaar, das seine (nach alter Weise dreitägige) Hochzeit oder die Taufe seiner Kinder feierte, mußte für die Benutzung des Hauses ein Geschenk an Geld oder Leinen geben. Dies wurde durch eine „Hochzeitsordnung des Raths zu Fritzlar wegen der Hochzeiten auf dem Hochzeitshause“ bestimmt. Jedes Hochzeitspaar erhielt für seine gestiftete Gabe das Recht, das übriggebliebene Bier, das für seine Feier gebraut worden war, im Hochzeitshaus „verkäuflich zu verzapfen“. Im Jahre. 1662 mußte das Haus repariert werden, 1681 folgte eine Erneuerung des Daches. Im Siebenjährigen Kriege diente es als Militärlazarett; damals ging das ganze Inventar verloren. Dann wurde das Gebäude so baufällig, daß man es nur noch als Holz- und Fruchtmagazin benutzen konnte. 1827 wurde es nach Wiederherstellung von der Stadt „zur Menage für das Kurhessische erste Husarenregiment“ eingerichtet und von 1851 bis 1863 als Rathaus, nebenbei als Kriminalgerichtslokal, benutzt. Im Jahre 1903 ging man aber daran, das Haus für städtische Schulzwecke zu verändern. Bei den Umbauarbeiten fand man (1904) gotische Türgewände in den Mauern und auch Eckblattbasen von zwei romanischen Säulen. Die nordöstliche Ecke des steinernen Unterstocks zeigte übereinander zwei mit rippenlosen Kreuzgewölben überdeckte quadratische Gelasse, die ihrer Fensterarchitektur nach dem älteren Bau angehörten. Der heutige Fachwerkbau in reicher Renaissance, der vor 100 Jahren noch verputzt war, ist mit kräftig gezeichneten Gesimsen ausgestattet und besitzt ein steinernes Erdgeschoß. An der südlichen Giebelseite befindet sich ein zweigeschossiger Holzerker, an der Westseite ein Treppenhausvorbau mit ornamentiertem Portal. Letzteres wurde 1590 von dem Kasseler Bildhauer und Bildschnitzer Andreas Herber geschaffen und 1971 von dem Bildhauer Horst Jaritz (Löhlbach) erneuert. Da die Ornamente und Figuren durch Witterungseinflüsse sehr gelitten hatten, mußten die Profile des Portals, der Fries und andere Teile restauriert sowie die Kartuschen und Ornamente ergänzt werden. Das Hochzeitshaus enthielt im Erd- und ersten Obergeschoß ehemals je einen großen Saal mit Balkendecke auf vier mächtigen Holzstützen. Während der Saal im Erdgeschoß größtenteils erhalten ist, sind beide Stockwerke heute in Zimmer aufgeteilt.
Als nach dem letzten Kriege unter der Leitung von Ludwig Köhler in Fritzlar die Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte gegründet wurde, wies man ihr zur Einrichtung eines Heimatmuseums zunächst einen Teil des historischen Hochzeitshauses zu. Nach der Beseitigung von Witterungsschäden in den oberen Geschossen des schönen alten Baues, für dessen Erhaltung die Stadtverwaltung seit 1954 Mittel bereitstellt, konnten die „Ur- und frühgeschichtlichen Sammlungen“ 1956 eingerichtet werden. „Ziel des Museums ist es, ein möglichst lückenloses Bild von der Besiedlung, den Kulturen, der Bevölkerung, der Volkskunst, von Handwerk, Handel und Gewerbe im Gebiet des Kreises Fritzlar-Homberg - mit dem Schwerpunkt Geschichte der Stadt Fritzlar im historischen Teil - zu geben“. So beurteilten die Gründer ihre Aufgabe.
Schon vor Beginn der 1967 erfolgten Einrichtung der historisch-volkskundlichen Abteilung und der Geologie wurden von der Museumsleitung bestimmte Schwerpunkte gesetzt, um sich von anderen Heimatmuseen zu unterscheiden. Im Erdgeschoß des Hauses befindet sich das Vorgeschichtsmuseum, das seit Jahren einen guten Namen hat und Werkzeuge aus allen Abschnitten der Jungsteinzeit, Keramik und Werkzeuge von neolithischen Höhensiedlungen sowie Funde aus der Bronzezeit, der Eisenzeit, aus der römischen Kaiserzeit, der merowingisch-karolingischen Zeit, frühmittelalterliche Keramik usw. besitzt.
Der volkskundliche Teil des Heimatmuseums hat im ersten Stock Platz gefunden. Er enthält u. a. eine größere Truhensammlung, Schränke, Bauernmöbel, bäuerliches Gerät, eine besondere Sammlung „Spinnen und Weben“ und eine Sammlung von gußeisernen Etagenöfen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Ferner sieht der Besucher Feuerwaffen, Hausgerät, Geschirr. Fritzlarer Steinzeug und eine umfangreiche Sammlung von Dachziegeln mit Inschriften, Jahreszahlen, Signaturen und figürlichen Darstellungen. Einen eindrucksvollen Überblick über die geologische Struktur des Kreises gewährt die erdgeschichtliche und naturkundliche Abteilung, die die Funde in den größeren Zusammenhang stellt. Hierzu gehören Fossilien und Fährtenplatten aus dem Perm. Schließlich umfaßt das Museum Dinge aus der Kulturgeschichte der Stadt Fritzlar und der dörflichen Umgebung.
Bis zur 1250-Jahrfeier der Kreisstadt im Jahre 1974 soll das Heimatmuseum im Hochzeitshaus komplett eingerichtet sein. Dazu sind noch umfangreiche Arbeiten im zweiten Obergeschoß notwendig.
H.J.Heer
Wochenspiegel Nr. 39/06, vom 22. September 1972, S. 1-2.4
UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN
Quellen und Brunnen im alten Fritzlar von H. J. Heer
Eines der wichtigsten Stoffe zum Leben für Menschen, Tiere und Pflanzen ist das Wasser. Darum waren zu allen Zeiten Quellen und Brunnen Orte der Verehrung, so daß man von einem regelrechten Quellenkult bei allen Völkern in der Vergangenheit sprechen kann.
Die Höhe von Fritzlar mit ihrem lieblichen Edertal war reich an solchen Quellen. Aus diesem Grunde siedelten sich nach der Fällung der Donareiche am heutigen Domplatz und der Christianisierung der Chatten die Bewohner der merowingischen Stadt Büraberg freiwillig auf dieser südlichen Höhe an, da hier die Agrar- und Wasserverhältnisse bessere Lebensbedingungen brachten.
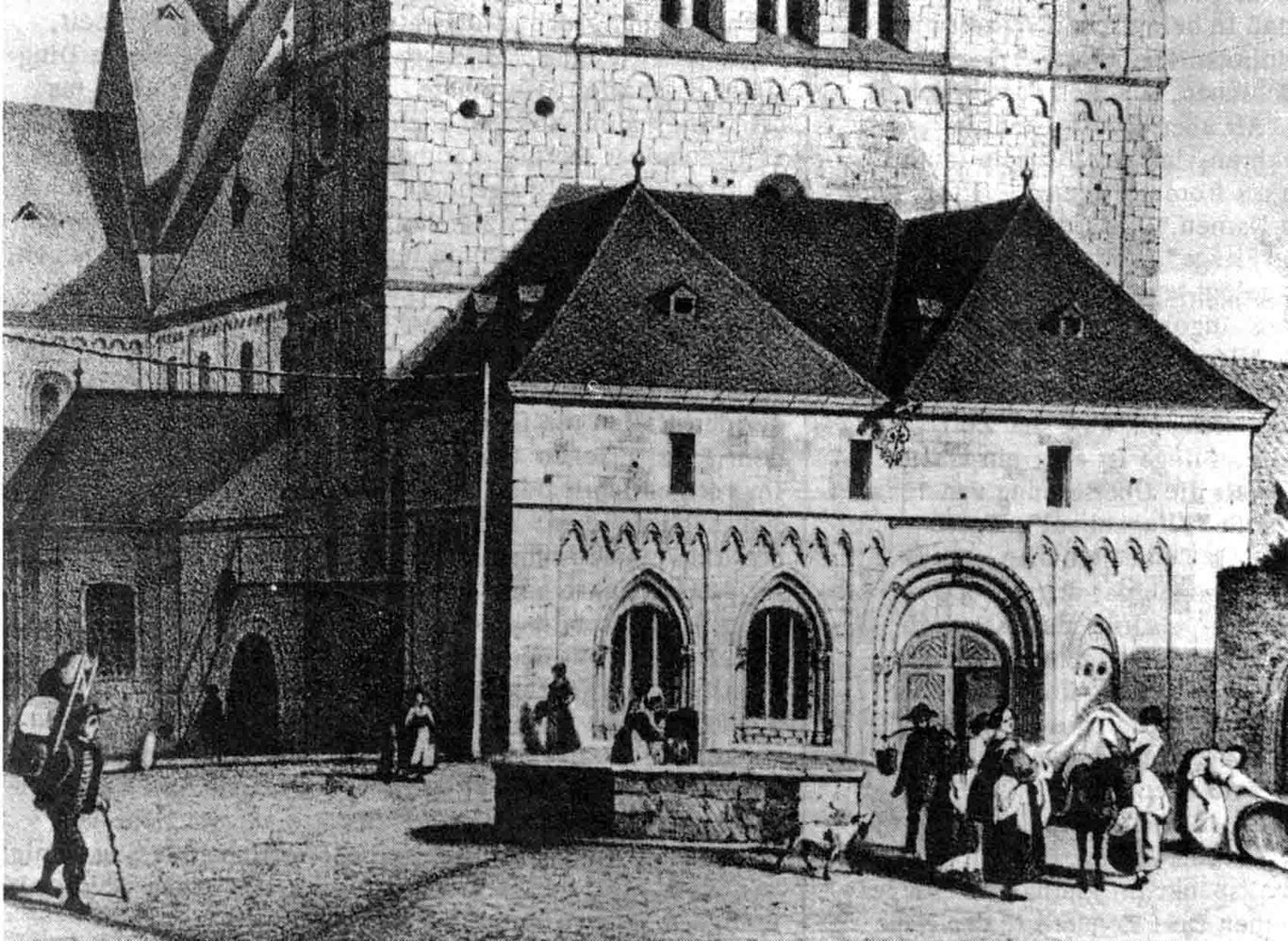
"Der Kump"
Msgr. Dr; Jestädt befaßte sich in einem wissenschaftlichen Aufsatz mit den drei heiligen Quellen aus chattischer Vorzeit (Hessenland, Heft 5, 1925), Er schreibt u, a, wie folgt: „Am Südabhang der Höhe, auf der sich Fritzlar und sein Dom erhebt, entspringen drei Quellen. Zunächst im Klostergarten der Ursulinen die „Hetze“ (Lazzenborn, Leezige), östlich davon der „Riegelbrunnen“ (regilbrunnen), westlich der „Fleckenbrunnen“, Im Mittelalter hieß die Hetze „Bonifatiusborn“, 1239 stand dabei eine Bonifatiuskapelle“. Nach Auffassung der christlichen Missionare waren die heidnischen Götter Teufel, ihr Kult Teufelskult und ihre Stätten Teufelsstätten, Darum sagte schon Gregor der Große in seiner berühmten Missionsanweisung vom Jahre 601: „Sie sollen nicht mehr dem Teufel Tiere opfern“ und das Kapitulare von, 785 belegt den in Artikel 9 mit schwerer Strafe, der „einen Menschen dem Teufel opfert und ihn nach heidnischer Sitte den bösen Geistern als Opfer darbringt“. Um nun die Erinnerung an die Teufelsverehrung vollständig auszulöschen, vernichteten die Glaubensboten nach derselben päpstlichen Anweisung die zahlreichen heiligen Götterbäume, errichteten an ihrer Stelle christliche Heiligtümer und gaben ihnen christliche Namen. Heilige Quellen konnten sie jedoch nicht vernichten. Deshalb tauften sie sie um und gaben ihnen christliche Namen. Überall sollte der neue christliche Name die Erinnerung an die alten Götter und Götterstätten auslöschen.
Daß die Quelle am Südabhang des Fritzlarer Domberges, der Hazzenborn, „Bonifatiusquelle“ genannt wurde, läßt die Vermutung zu, daß es sich hier vielleicht um eine chattische heilige Quelle handeln kann. Da sie überdies unmittelbar unter der Domhöhe in der Mitte zwischen den beiden anderen Quellen liegt, dazu noch durch eine eigene Bonifatiuskapelle betont wird, dürfte diese unter den drei Quellen vielleicht als heilige und deshalb bevorzugteste Quelle gegolten haben. Auch die Quellen rechts und links vom Bonifatiusborn haben Teufelsnamen, nämlich „Fleckenbrunnen“ und „Riegelbrunnen“. Was ersteren angeht, ist dieser unter den drei Quellen am Südhang der Domhöhe durch eine besondere Sage ausgezeichnet - die Fleckenssage. Sie gilt als Beweis für das hohe Alter des Brunnens und seines Namens, Sie erzählt, daß in heidnischer Vorzeit hier an diesem Brunnen ein heidnischer Riese mit Namen „Flecke“ der, nach Opfern gierig, Menschen, die sich durstig der Quelle nahten, verschlang. Als aber das Christentum ins Land kam, ließ er sich bekehren, in seiner Quelle taufen und führte fortan ein Leben als frommer Eremit. Hinter dem unmythologisch klingenden Namen „Flecke“, verbirgt sich ein Teufelsname, nämlich „Fliege“, der nach Grimms Mythologie dem Teufel beigelegt wurde. Wenn man bedenkt, daß die hessischen Missionare Angelsachsen waren und daß im Angelsächsischen Fliege „fléoge“ heißt, so hätte der Brunnen von den angelsächsischen Glaubensboten den Namen „fleogebrunno“ erhalten, der sich im Laufe der Zeit zum „Fleckenbrunnen“ abwandelte, Fliege ist aber ein uralter Teufelsname, nichts anderes als die Übersetzung von „Baal“ und Beelzebub; Beelzebub heißt „Fliegenbaal“. Diese Deutung des Fleckenbrunnens als Teufelsbrunnen, Götterbrunnen, wird noch durch den Namen der dritten Quelle, „Riegelbrunnen“ (regilbrunnen) gestützt, der östlich der Hetze liegt. Ein mittelalterlicher Befestigungsturm trägt von der Quelle den Namen „Riegelturm“. Riegel ist aber ähnlich wie Fliege nach Grimms Mythologie ein Name für Teufel. Demnach dürfte auch der Riegelbrunnen als Teufelsbrunnen oder Götterbrunnen zu deuten sein. Nun bleibt noch festzustellen, welcher Götterdreiheit diese drei heiligen Quellen wohl geweiht waren. Für den Riegelbrunnen findet sich ein Anhaltspunkt im Flurnamen „Riegelgraben“, der östlich vom nahen Dorf Zennern in der Nähe der alten Wodanstätte Udenborn verläuft. Gräben, Hohlwege und Schluchten waren bei den Germanen mit Vorliebe Kultstätten. Der Riegelgraben, Teufels- oder Göttergraben dürfte somit als Wodansgraben anzusprechen sein. Demnach wäre der Fritzlarer Riegelbrunnen dem Gott Wodan geheiligt, der Fleckenbrunnen, der nach der Volkssage auch Fritzlars Kinderbrunnen ist, der Menschenmutter Freia geweiht. Der Riese Flecke, der darin hausen sollte, wäre dann kein anderer als Freias Gemahl Ziu gewesen. Als dritter Brunnen verbleibt der Hazze-Bonitatiusquell, der dann als der Donarquell zu deuten wäre. Dem Gott Donar waren nämlich nicht nur Höhen und Bäume, sondern auch Quellen heilig.
Die germanische Götterdreiheit Ziu, Donar und Wodan hätte dann int. den drei heiligen Quellen unter Hervorhebung der mittleren Donarquelle am Südhang der Domhöhe - die Germanen orientierten ihre Kultstätten gern nach Süden - eine Kultstätte gehabt. Interessant ist der Vergleich der Fritzlarer Anlage mit den drei Quellen am Südabhang mit der Anlage der Irminsul, dem Nationalheiligtum der Sachsen. Nach Feststellung des Forschers Kuhlmann besteht wohl kein Zweifel daran, daß die Irminsul, ein Baumstamm von mächtiger Größe, auf dem Eresberg an der Stätte des heutigen Obermarsberges an der Diemel stand. Auch hier sind, wie in Fritzlar, am Abhang der heiligen Höhe drei Quellen vorhanden. Man wird dabei auch unwillkürlich an die heilige Weltesche Yggdrasils asker erinnert, unter deren Schatten drei heilige Quellen entsprangen. (Weltesche ist in der altnordischen Sage der himmeltragende Weltenbaum Yggdrasil, der mit seinen Wurzeln in die Reiche der Götter, Riesen und Toten reicht).
Soweit ein Auszug aus der umfangreichen mythologischen ortsgeschichtlichen Forschung von Dechant Jestädt. Er selbst konnte sich nicht ganz zu der Tatsache durchringen, daß das Heiligtum der Chatten am Fritzlarer Domplatz stand. Dafür spricht sich aber heute der größte Teil der zuständigen Fachwissenschaftler aus. Hierdurch ergibt sich die Erklärung für den Standort des heutigen Doms. Die Stelle der Donareiche bot keinen idealen Baugrund für ein derart großes Bauwerk; die Höhe am Rathaus hätte sich weit besser geeignet. Die Fritzlarer Donareiche hatte nicht nur für ihre Zeit religiöse Bedeutung, sondern ihr Platz war auch eine der großen Dingstätten aus germanischer Zeit. Man hatte diesbezüglich feste Vorstellungen wie eine Dingstätte beschaffen sein mußte. So gehörte zu ihr nicht nur der Götterbaum, sondern auch eine heilige sprudelnde Quelle. Falckenheiner schreibt darüber 1841 in seinem Buch „Geschichte Fritzlars“ folgendes: „Das ältere mallum (Gerichts- und Dingstätte) in Fritzlar lag bei der Stiftskirche. Um den Richtern und der versammelten Menge Schutz gegen Regen, Schnee und Sonnenbrand zu gewähren, war es mit einem Bretterdach (testudo) überdeckt, nach den Seiten hin aber wahrscheinlich, wie alle ähnlichen Plätze, von bedeckten Gängen umgeben. Es hieß daher Halle (atrium). Selbst der den Hallen nie fehlende Quell oder Brunnen war auf dem Fritzlar´schen Gerichtsplatz vorhanden und wurde erst im vorigen Jahrhundert zugeworfen; das ist mehrmals urkundlich nachgewiesen. Auf der Fritzlarer Dingstätte wurde in der früheren deutschen Vergangenheit nicht nur Orts- und Landesgeschichte gemacht, sondern die Dingstätte diente auch für die Reichs- und Weltgeschichte als Bühne. Eine Urkunde aus dem Jahre 1368 überliefert uns einen „Heiligenbornweg“ unterhalb der Äcker am Hellen; man könnte sich ihn etwa in der Gegend am alten Geismarrain vorstellen, wo noch heute mehrere Quellen zutage treten. All diese Anhäufung von kultischen Quellenhinweisen rundet das Bild der chattischen Kultstätte auf der Höhe von Fritzlar ab, Wahrscheinlich war dieses Höhenplateau weniger besiedelt, weil die vermeintlich dort wohnenden Götter als furchterregend galten.
Die Bewohner siedelten sich mehr rings um den Berg an, wobei die größere Anzahl wahrscheinlich an der Südwestseite in Geismar ihre Häuser hatte.
Die Bodenforschung hat in den letzten Jahren bei Frau-Münster auch eine größere Urnengräbersiedlung feststellen können: Hieraus erklärt es sich möglicherweise, warum Geismar schon so früh in der Geschichtsschreibung erwähnt wird. In späteren Jahren zogen die Bewohner von Geismar einmal jährlich mit einem Baum zum Domplatz, um die Erinnerung an die Fällung der Donareiche zu feiern.
Das Gebiet um das Höhenplateau muß stark bevölkert gewesen sein; denn auch für Missionare des 8. Jahrhunderts lohnte sich nur eine Missionierung größeren Stils, wo Mittelpunkte von Siedlungsgebieten waren. Mit der Christianisierung war die heidnische Geisterwelt gebannt und so entwickelte sich die Stätte des Friedens = Fritzlar schnell zur Landeshauptstadt von Niederhessen.
Fortsetzung folgt
Wochenspiegel Nr. 40/06, vom 29. September 1972, S. 1-2
UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN
FORTSETZUNG
Quellen und Brunnen im alten Fritzlar
von H. J. HEER
Fritzlar galt schon um 1300 mit 2.000 bis 3.000 Einwohnern als dicht besiedelt und war für die Wasserversorgung von großer Bedeutung, die durch die zahlreichen Brunnen gewährleistet war.
Folgende Brunnen lassen sich noch heute urkundlich nachweisen: Am Marktplatz befand sich vor der heutigen „Spitze“ der Guntramsbronn, ferner der Rolandsbrunnen, welcher gleichzeitig als Rechtswahrzeichen galt und der untere Marktbrunnen, etwa da, wo heute die Verkehrsinsel angelegt ist. Am Hochzeitshaus, vor der Mauer nach Orth zu, befand sich der nächste Brunnen.
Beim Haddamartor/Ecke Hardehäuser Hof und Schuhhaus Bade war ein weiterer Brunnen vorhanden. Der Jordansbrunnen, auch Jüdenborn genannt, befand sich da, wo heute der Baum am Jordan steht. Bei der Nikolauskirche, am heutigen Posthof, waren gleich zwei Brunnen vorhanden, wie sich bei den letzten Bauarbeiten feststellen ließ.

Über einen weiteren Brunnen verfügte Fritzlar in dsr Flehmengasse beim Deutschordenshof, etwa bei der jetzigen zweiten Ausfahrt der Großhandlung Schmitt & Durstewitz. Das Viertel um die Fraumünster-straße bezog ihr Wasser von dem Riegelbrunnen, dessen gotisches Tor noch neben dem Wohnhaus Buchenhorst in der Riegelgasse erhalten ist. Die Neustadt versorgte sich hauptsächlich mit Wasser aus dem Fleckenbrunnen, dessen großer steinerne Trog an der Mauer des Amberges, gegenüber der heutigen Klosterschenke, stand. Das Quellwasser des Steingossen- und Haz-zenborns (Bonifatiusbrunnen) war mehr dem Stiftsherren- und Bürgerbad vorbehalten. Die Bürgerbadstube befand sich im Hause Arend bei den Treppen zum Bleichentor, das Stiftsherrenbad lag in dem rechts abbiegenden Gäßchen, etwa in der Nähe der neuen Ursulinenschule, die heute das Quellwasser für ihr Hallenbad nutzt.
Eine Urkunde vom 12. Okt. 1454 gibt uns Einblick in die Badstube der Stiftsherren. Sie lautet: „Peter Badstuber und seine Frau verpflichten sich, den Kanonikern eine reinliche Kammer und Stube im Badhaus zu halten, ihnen damit zu dienen und den in die Badstube geleiteten Wassergang instandzuhalten. Die Kanoniker haben Peter einen guten Badkessel und 3 Wassersteine überlassen, die er ersetzen soll, wenn sie abgenutzt oder zerbrochen sind.“ (Wahrscheinlich handelt es sich um Steine, die für das Dampfbad erhitzt wurden). Am Domplatz befand sich der schon erwähnte Gerichtsbrunnen sowie mehrere Hausbrunnen in den ehemaligen Stiftskurien, in der Dechanei und der alten Küsterei. Der Burgbrunnen des Erzbischofs lag auf dem Gelände von St. Wigbert.
Um aber den immer größer werdenden Wasserbedarf zu decken, sah sich die Stadt schon früh veranlaßt, eine zusätzliche Wasseranlage zu schaffen. FALCKENHEINER schreibt 1841 darüber: „Die vielfach erwähnte Wasserkunst, durch welche die Altstadt Fritzlar hauptsächlich mit Flußwasser versorgt wird, reicht bis in das 14. Jahrhundert zurück. 1609 legte sie der Stadtrat „unter das St. Catharinenkloster“ (heute Ursulinen) und erlangte von dem Stift die Erlaubnis, das Wasser der Steingosse hierzu verwenden zu dürfen. Späterhin finden wir sie unter dem Dach der inzwischen städtisch gewordenen Mönchmühle angebracht, deren Besitzer auch noch jetzt immer dieses Servitut zu tragen hat. Dieses Kunstwerk treibt das Wasser in eisernen Röhren den Mühlenberg und Amberg hinauf bis zum großen Kump vor der Stiftskirche. Hier teilte sich ihr Gang ehemals in zwei Arme, von denen einer über den oberen Friedhof an der Johanniskirche hin in die Küche des Hochzeitshauses lief, während der andere durch die Krämen in das obere Brauhaus abzweigte, sodann das Wasserbecken auf dem Markt (Rolandsbrunnen) versorgte, weiter durch die Werkelgasse in das untere Brauhaus führte und hier, an seinem Ende, am Klobesplatz, das ihm auf dem weiten Weg noch verbliebene Wasser zu jedermanns freiem Gebrauch ausgoß“.
Zu den jährlichen Festen und Bräuchen in der Vergangenheit gehörten die Brunnenfeste, denen die Reinigung vorausging und mit Umtrunk und Tanz gefeiert wurde. Diese Brunnenfeste, sogenannte Brunnenzechen, lassen sich seit dem Jahre 1683 nachweisen. Sie wurden zweimal im Jahr, und zwar am 2. Pfingsttag und am St. Johannistag (24. Juni) begangen. LANDAU, der 1859 die Sitten und Bräuche in Hessen aufzeichnete, schrieb u. a. über die Brunnenzechen von Eschwege, Treysa und Fulda - in Fritzlar wird die Durchführung wahrscheinlich nicht anders gewesen sein - folgendes: „Am St. Johannistag finden auch die Brunnenzechen statt. Die zu einem Brunnen gehörige Nachbarschaft schmückt diesen mit Blumenkränzen und Laub und wählt dann einen Brunnenherrn, dem die Wahl durch Zusendung eines Blumenstraußes verkündet wird. Die Kinder ziehen in einer Prozession zu seinem Hause und pflanzen vor demselben grünen Maien auf, während der Brunnenherr sich aufmachte, um von Haus zu Haus Gaben zu sammeln, von denen die Kosten der Brunnenzeche, die einige Tage später gehalten wird, bestritten werden. Am Abend vor der Brunnenzeche spielt die Musik vor den Türen und am Nachmittag des Festes versammeln sich die benachbarten Frauen bei der Brunnenfrau zum Kaffee und ziehen nach dessen Genuß, begleitet von der jubelnden Jugend, zum Saal, in dem die „Zeche“ stattfindet, die in einem gemeinsamen Mahl und Tanz besteht“.
Wie wir auf der Marktplatzzeichnung im Schnee aus dem 19. Jahrhundert ersehen, wurde auch in Fritzlar der Rolandsbrunnen mit einem Blütenkranz geschmückt, und jung und alt haben sich an dem Brunnenfest erfreut. Darum kann man unseren Heimatdichter Rektor Heinrich WINTER verstehen, daß er, als im Jahre 1898 die Wasserleitung gebaut wurde, in seinem Gedicht „Die alle Zitt“ (alte Zeit) wehmütig eine Strophe schrieb, die da lautete:
„Gebumpet wurde's Wasser noch,
un's Geld war noch im Husse;
jetzt zapt derheime mancher, doch
de Heller bumpen musse.
Un wie de Wasserlitung kam,
der Anton+) sinnen Abschied nahm,
O jerum, jerum jeite, de ahle Zitt is pleite“.
+) Anton war der Eckensteher, der sich mit Wassertragen ein paar Pfennige verdiente.
(Schluß)
Wochenspiegel Nr. 41/06, vom 06. Oktober 1972, S. 1-2
UNSERE STADT, IN DER WIR LEBEN
Das Chorherrenstift St. Peter zu Fritzlar, eine Stätte des geistigen Lebens im mittelalterlichen Hessen I.
Aus der von Bonifatius gegründeten und Abt Wigbert geführten benediktinischen Klosterschule des 8. Jahrhunderts entwickelte sich etwa nach 1000 eine Hochschule mit akademischen Studienfächern. Bei der Umwandlung des Fritzlarer Benediktinerklosters in ein adliges Chorherrenstift um die Jahrtausendwende, war eine der wichtigsten Einrichtungen die Führung einer eigenen Stiftsschule.
An ihrer Spitze stand der Scholaster (scholaster, scholadicus), der im Range der zweithöchste unter den 3 Prälaten des Fritzlarer Stifts war. Die Bezeichnung des Scholasters als „magister scholarum“ (schon 1190), die des Rektor: als „rector scholarum“ (1314) beweist, daß es damals nicht bloß eine Schule in Fritzlar gegeben hat, sondern daß außer der internen Stiftsschule auch noch eine externe Stadtschule vom Stift unterhalten wurde.
Gelehrt wurde an der Fritzlarer Stiftsschule Sprachen, Theologie, Jurisprudenz und die schönen Künste wie: Musik, Dichtung, Buchschreib- und Malerei sowie Goldschmiedekunst.
Es spricht für den hohen Stand der Schule, wenn sich Landgraf Hermann von Thüringen und Herr von Hessen (1190 - 1216), der Gönner und Freund der schönen Dichtung, aus Fritzlar einen gelehrten Schüler erbat, um sich von ihm eine Bearbeitung des Trojanerkrieges in deutschen Versen liefern zu lassen. Herbort von Fritzlar hat diesen ehrenvollen Auftrag in 18 458 Versen gedichtet.
Weiterhin ist urkundlich nachweisbar, daß schon 1290 die Universitäten Paris und Bologna ausdrücklich als akademische Fortbildungsstätten der Fritzlarer Scholaren bezeichnet werden. Zum Stift und seiner Schule gehörte eine berühmte Handschriften-Bibliothek, die durch einen eignen Bibliothekar und Buchbinder (negociator librorum) im Stand gehalten wurde. Ein Beschluß v. J. 1387 verfügte regelmäßige jährliche Revisionen der Stiftsbibliothek durch gewissenhafte und erprobte Personen der Stiftskirche. Sorgfältig sollte von ihnen die Bücherei nach Zustand, Wert und Zahl der darin oder an anderen Stellen frei oder angekettet befindlichen Bücher geprüft werden. Das vorhandene Handschriftenmaterial ging in die Tausende, welche kostbaren Bände das Stift früher besaß, beweisen die noch heute erhaltenen besonders kunstvollen 48 Bände im Schloß Pommersfelden bei Bamberg und die in der Landesbibliothek in Kassel mit über Hundert Bänden, deren Werte mehrere Millionen übersteigen.
Der damalige Bibliothekar und Stiftsscholaster von Speckmann schreibt 1742: „bey einer Kurfürstlichen Commission Churfürst Lothar Franz von Schönbom, Erzbischof von Mainz, sehr schöne Manuscripte in Pergament sich ausgebeten und von dem Stift empfangen, sind aber noch 200 übrig.“ An anderer Stelle schreibt Speckmann vom gleichen Jahre: „Ist das Obergebäude der Stiftsbibliothek ober dem Kreuzgang verfallen und durch die Bunnengefach sind zwey Wagen voll Bücher inbrauchbar hinweggeworfen worden.“ Den größten Verlust erlebte Fritzlar bei der Säkularisation 1803 wo das Stift aufgelöst wurde und das gesamte Vermögen an den Landgrafen von Hessen-Kassel fiel, hierbei gingen ganze Wagenladungen von Handschriften und gedruckten Bänden in die Bibliotheken nach Kassel. Ob nun dieselben Fritzlar erhalten geblieben wären, in den Stürmen der letzten 170 Jahren, kann man nicht mit Sicherheit sagen, wenigstens sind sie nach der Absetzung der hessischen Landgrafen in den Besitz des Landes Hessen gekommen und stehen heute der Forschung offen. Die deutsche Forschungsgemeinschaft stellte z. B. 1960 für Kassel 56.000,-- DM zur Verfügung um diese Handschriften zu katalogisieren, dessen erster gedruckter Band 1969 unter den Titel erschien: „Die Handschriften der Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibliothek Band 2, MANUSCRIPTE IURIDICA“. Bearbeitet von Marita Kremer, herausgegeben von Dr. Ludwig Denecke, 1969, Verlag: Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
Frau Kremer bedankt sich für die Mitarbeit von 14 Professoren und 16 Doktoren aus dem In- und Ausland und schreibt unter anderem in ihren Vorwort: „Die `Manuscripta iuridica´ nach der Einteilung des alten handschriftlichen Katalogs umfassen 149 Handschriften und Fragmente aus dem Römischen, dem Kanonischen, dem Zivil- und Völkerrecht, darunter auch einiges, was man heute nicht unbedingt als juristisch bezeichnen wurde Den wichtigsten Teil der Sammlung bilden die Codices und Fragmente aus der Bibliothek des Domstifts St. Peter in Fritzlar, die mit 54 mittelalterlichen Stücken ein sehr aufschlußreiches Bild von dem Zustandekommen und den Gehalt einer solchen Dombibliothek zu geben vermögen.“
Von den 149 Handschriften vom 9. bis zum 19. Jahrhundert, bilden die 54 Bände aus Fritzlar ca. 90 % aller wertvollen mittelalterlichen Schriften vom 9. bis zum 15. Jahrhundert, welche zum größten Teil auf Pergament und mit kostbaren Initialen (mit farbigen Bildwiedergaben aus dem Gerichtsleben) ausgeschmückt sind. Diese Bände hatten auch zu ihrer Entstehungszeit großen Wert, welches die Kettenhalterungen an den Büchern beweisen, die sie vor Diebstahl schützen sollte. Es handelt sich bei den Bänden um ganze Handschriftenpakete bis zu 600 Seiten, aus denen man außer juristischem auch viel Geschichtliches und sogar berühmte Reimdichtungen des Mittelalters finden kann.
Aus dieser Stiftsschule hervorgegangene Stiftsherren finden sich, wie ein Blick in die Register der meisten Urkundenwerke lehrt, weit über die Grenzen des Archidiakonatsbezirks Fritzlar hinaus als „notarii“ und „scriptores“ (Notar und Schreiber) oder hohe geistliche Würdenträger in Mainz, Aschaffenburg, Paderborn, Minden, Hildesheim, Osnabrück, Halberstadt, Erfurt, Magdeburg, ja in allen größeren Orten Norddeutschlands wie auch als Kurialen zu Avignon und Rom.
von H. J. Heer
Wochenspiegel Nr. 48/06, vom 24. November 1972, S. 1-2
UNSERE STADT, IN DER WIR LEBEN
Das Chorherrenstift St. Peter, zu Fritzlar , eine Stätte des geistigen Lebens im mittelalterlichen Hessen II.
Bis zur Reformation wurden ferner viele Kanoniker von den damaligen Fürsten als Kanzler herangezogen. 1194 nennt Erzbischof Siegfried von Mainz den Kan. Hermanus von Fritzlar als Notar, 1196 - 1207 wird Adeleldus aus Fritzlar als solchen genannt. Eckerardus von Momberg wurde 1248 Propst und Archidiakon des St. Peterstiftes in Fritzlar, er führte im Verein mit Konrad v. Elben und Werner v. Löwenstein im Auftrage des Markgrafen Heinrich v. Meißen die vormundschaftliche Regierung für den minderjährigen Heinrich v. Brabant, das Kind von Hessen der spätere Landgraf. 1246 - 47 war der Fritzlarer Propst Burkardus von Ziegenhain Kanzler Heinrich Raspes der Schwager der Hl. Elisabeth von Thüringen. Auch sein Nachfolger, Wilhelm von Holland´s Kanzler, war Wilhelmus de Frieslarfa.
1279 wird Henricus de Anreff can. fritl. Kanzler des Landgrafen Heinrich von Hessen. 1354 war Bertram v. Wolfshain can. fritl. protnotarius des Landgrafen. 1377 ist Heidenrikus von Fritzlar notarius von Adolphi I., Tilmann Hollauch, ein Fritzlarer Altarist, war 1413 - 58 Kanzler des Landgrafen Ludwig I. Unter den Räten dieses Landgrafen waren Dietrich v. Uffeln can. fritl. sowie die Altaristen Joh. Torlan und Joh. Morsen sind seine Räte. 1419 ist Volpert Regis de Fridslaria Notar und Schreiber des Mainzer Stuhles. 1434 war Joh. Kirchhain, später Dekan des St. Peterstiftes, „Kammerschreiber“ des Erzbischofs. 1465 war Conrad Balke can. fritl. landgräflicher Kanzler. 1465 war Dr. Joh. Herdeyn aus Fritzlar „Heimlicher Rat“ des Landgrafen Hermann, 1479 Dr. Joh. Menche, scolast. fritl. Notar und Rat des Landgrafen Heinrich, 1483 wurde er als prepositus fritl. Kanzler Landgraf Hermanns zu Hes-sen, Erzbischof von Köln.
Die Fritzlarer Stiftsschule mit ihren bedeutenden Juristen war sicherlich der Anlaß für „das Landfriedensgericht“, ein Bündnis, welches in Fritzlar gegründet und wiederholt dort tagte. Um den fortwährenden Räubereien, Wegelagerungen und Plünderungen, Gewalttätigkeiten usw., die zu einer wahren Landplage geworden waren, ein Ende zu machen, traten eine Anzahl Fürsten zu Bündnissen zusammen, welche den Zweck hatten, diese Ausschreitungen zu unterdrücken und vorkommende Streitigkeiten durch Landrichter zu schlichten.
So schlossen Erzbischof Gerlach und Landgraf Heinrich 1. 1254 einen solchen Landfrieden. Ihre Landrichter traten z. B. 1266, den 3. Mai in Fritzlar zusammen, um Meinungsverschiedenheiten zu schlichten. Nachdem nochmals 1273 bei Fritzlar zwischen Erzbischof und Landgrafen neue Vereinbarungen getroffen waren, traten 1293, weil die Verhältnisse inzwischen wieder unerträglich geworden waren, die Städte Fritzlar, Naumburg, Hofgeismar, Wolfhagen, Warburg, Marsberg und Höxter zu einem Landfriedensbunde zusammen. 1361 und 1370 finden wieder Vereinigungen zwischen den beiderseitigen Landesherren in Fritzlar statt. Jetzt treten auch benachbarte Fürsten dem Bunde bei. Am 12. März 1385 verbünden sich Erzbischof Adolf, Herzog Otto von Braunschweig, die Grafen von Waldeck und Ziegenhain und viele Ritter und Knappen. Zur Leitung der Geschäfte sollen der Erzbischof drei, das Land Westfalen drei, das Land Sachsen drei und die Lande zu Hessen und in der Buchenau (Fulda) drei Abgeordnete wählen, „und wann die gekorne also alle zusamen ryden wurden, daz solde gescheen gein friczlar“ (aus Braunschw. Urkb. VI p. 123). 1393 traten dem Bunde die Bischöfe von Paderborn, der Landgraf Balthasar von Thüringen und Markgraf zu Meißen, sowie Landgraf Hermann von Hessen bei.
„Auch sind wir fursten überkomen, waz das wir alle jare eyns czusamen komen sollen czu Friczlar mit namen uff den suntag nach mitfasten, und dazu überkomen, waz nucze gut sie czu dem fride“ (Cod. dipl. Sax.). 1401 ritten die Schiedsleute noch nach Fritzlar. In der Rechnung der Stadt Hildesheim heißt es da: „de hovetman verdan do he reden was van unses herrn weghen an de lantrichtere to Fritzlar“. In der Mitte des 15. Jahrhunderts verlieren sich die Richtertagungen in Fritzlar.
All diese urkundlich belegten Vorkommnisse zeigen uns die bedeutende Stellung von Fritzlar im Mittelalter. Im Jubiläumsband der Philipps-Universität in Marburg zur Vierhundertjahrfeier des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, Band 56, 1927, von Seite 347 bis 436 beschreibt Dr. Karl Heldmann, Professor an der Universität Halle-Wittenberg, „Das akademische Fritzlar im Mittelalter“ in einem Beitrag zur Geschichte des geistigen Lebens in Hessen, worin er die Stiftsschule zu Fritzlar als ein Vorläufer der Philipps-Universität von Marburg sieht, als Abschlußkapitel folgendes: „Unbezweifelbar bleibt dennoch, daß das ungünstige, jedenfalls aus einem konfessionellen Vorurteil geborene Urteil über die Fritzlarer Stiftsschule im Mittelalter in keiner Weise zu recht besteht und allein schon durch die Listen der Scholaster, Graduierten und Studierenden, die wir nun folgen lassen, bündig wiederlegt wird. In Wahrheit ist das Fritzlar jener Jahrhunderte vielmehr der eigentliche Mittelpunkt des geistigen Lebens in Alt-Hessen gewesen, ein nicht bloß einfach kirchliches, sondern auch ein `akademisches Fritzlar´, das seine Rolle erst ausgespielt hat, als die neuen Geistesströmungen, Humanismus und Reformation, an seine Mauern heranbrandeten und im oberen Fürstentum Hessen die erste dem neuen Geist gewidmete Hochschule, Landgraf Philipps Universität zu Marburg, erstand. Ihr sei zu ihrem 400. Jubelfest diese Arbeit aus dankbarem Herzen dargebracht!“
(Es folgt dann der Nachweis bis zum Ende des 15. Jhrht. von cirka 500 Akademikern aus Fritzlar).
Hans Josef Heer
Wochenspiegel Nr. 32/07, vom 10. August 1973, S. 1
UNSERE STADT, IN DER WIR LEBEN
Aus Fritzlar´s Geschichte - Tilly und Piccolomini
Wenn wir diese beiden Namen nennen, werden wir an die unselige Zeit des 30jährigen Krieges erinnert, unter dem Fritzlar auch viel zu leiden hatte. Schon im Oktober 1621 mußte Fritzlar die Schrecken des Krieges verspüren, denn da zog der Herzog Christian von Braunschweig mit seinen plündernden Truppen durch unsere Stadt.
Doch die eigentliche Leidenszeit begann für Fritzlar 10 Jahre später. Am 9. September 1631 erschien der Landgraf Wilhelm von Hessen mit 3600 Fußsoldaten und 1000 Reitern in aller Früh vor dem Werkeltore. Da der Torwächter schlief, konnten die Hessen unbemerkt das Tor sprengen und drangen nun in die Stadt ein. Was sich ihnen entgegenstellte, wurde niedergemacht. Es kamen bei dieser Gelegenheit 28 Personen um, Nun wurde eine zweistündige Plünderung über Fritzlar verhängt. Auch die beiden Stiftsdörfer Ungedanken und Rothhelmshausen wurden ausgeplündert. Dann ritt der Landgraf mit gezogenem Schwert durch die Stadt und machte der Plünderung ein Ende. Fritzlar mußte aber monatlich 600 Taler Contribution bezahlen; alle Waffen, darunter eine Kanone, der große Hund genannt, die auf eine Entfernung von zwei Stunden getroffen haben soll, die Kriegsvorräte aus dem Zeughaus und die Archive fielen in die Hände der Feinde. Außerdem mußte die Stadt 2 Komp. hessischer Soldaten unterhalten,
Diesmal dauerte die Besatzung nicht lange, denn es rückte Tilly mit seinem Heere heran und kam am 10. Oktober 1632 in Fritzlar an. Aber schon am 12. Oktober zog er wieder weiter, und die Hessen besetzten die Stadt aufs neue.
Im Jahre 1640 kam das kaiserliche Heer, geführt vom Bruder des Kaisers, Erzherzog Leopold Wilhelm und dem Fürsten Piccolomini und besetzte die Stadt am 14. August. Das Hauptquartier befand sich damals im Gasthaus Lindenhof, dem jetzigen Julius Seibel'schen Wohnhaus am Markt.
Am 20. August rückte das schwedische Heer unter General Banner zwischen Züschen und Dorla heran, um die Kaiserlichen aus Fritzlar zu vertreiben. Nun verschanzten sich die Kaiserlichen am Mühlengraben oberhalb der Spitalsbrücke über Galbergerwarte, Eckerich, Hellenwarte, Kasseler- und Möllricherwarte, auch zwei Brückenköpfe an der Eder wurden angelegt. Die Reiterei verteilte sich in den Gärten um die Stadtmauer, während die Artillerie und das Fußvolk hinter den Schanzen lag. Die Bayern hatten ihre Kanonen nördlich der Hellenwarte aufgestellt. In der Nähe der Kasselerwarte stand das Feldherrnzelt des Fürsten Piccolomini. Zunächst wurde ein schwedisches Regiment durch kaiserliche Kürassiere am Hohenberge fast vollständig aufgerieben. Dann wurden sieben schwedische Schwadronen, die einen Durchbruch versuchten, bei Dorla zersprengt. Nun verschanzte sich General Bannert bei Wildungen. Die beiden Heere lagen jetzt nahe beieinander, und eine große Schlacht schien unvermeidlich.
Die Schweden versuchten, die am Mühlengraben unterhalb des Amberges gelegene Stiftsmühle zu zerstören, aber sie wurden mit Kanonen, die auf Schanzen in der Nähe des Domes standen, beschossen und in ihr Lager zurückgetrieben. Fürst Piccolomini erhielt trotz des Auflauerns der Schweden noch 4000 Reiter Verstärkung und fühlte sich stark genug, den Schweden acht Tage lang die Schlacht anzubieten. Als sie aber nicht angenommen wurde, zog er nach Beschießung des schwedischen Lagers über Wolfhagen und Warburg nach Höxter, Banner aber nach Münden. Nach Abzug der kaiserlichen Truppen wurde Fritzlar wieder von den Hessen besetzt. So wechselten Freund und Feind noch mehrmals ab, bis endlich im Jahre 1648 der Friede zustande kam. Fritzlar kam wieder an Mainz zurück. Von 700 Bürgern waren nach dem Kriege noch 400 übrig.
Wochenspiegel Nr. 02/10, vom 09. Januar 1976, S. 1-2
Deutsche Kaiser und Könige in Fritzlar
Der Besuch gekrönter Häupter war ein Beweis für die bedeutende Stellung unserer Stadt.
Das alte Urkundenarchiv von Fritzlar, unter dessen Bestand sich sicherlich auch mehrere Kaiserurkunden befanden, wie etwa die bedeutende Schenkung Karl des Großen an die Fritzlarer Kirche 782, sind durch die zwei großen Stadt- und Kirchenzerstörungen, 1079 durch die Sachsen und besonders 1232 durch Landgraf Konrad, vernichtet worden. Deshalb sind wir für die frühe Geschichtszeit auf Forschungsfunde anderer Archive angewiesen, mit dem Erfolg, daß man 1909 erst 13 Kaiseraufenthalte in Fritzlar nachweisen konnte, die sich aber bis heute schon auf 23 erhöht haben. Der Ausbau der königlichen Anlage in Fritzlar zur Pfalz erfolgte wahrscheinlich schon unter Karl dem Großen im Zusammenhang mit den Sachsenkriegen, denn das Vorhandensein einer Pfalz wird uns mehrmals quellenmäßig belegt.
Warum es im alten Deutschen Reich mal Könige und mal Kaiser gab, hat folgende Bewandtnis: die deutschen Könige wurden von den Fürsten, seit dem 13. Jahrhundert ausschließlich von den sieben Kurfürsten gewählt, aber nur in Rom von den Päpsten zum Römischen Kaiser gekrönt; es sind daher nicht alle Könige zu Kaisern gekrönt worden.Mit Maximilian 1. (1493 -1519) hörte die Krönung in Rom auf, der Gewählte nannte sich nun gleich mit der deutschen Wahl Römischer Kaiser.
Die Reichsinsignien, die Hoheitsabzeichen der deutschen Könige und Kaiser im alten Reich, bestanden in den Hauptteilen aus Krone, Zepter, Reichsapfel (Weltkugel mit Kreuz, ursprünglich Sinnbild der christlichen Weltherrschaft des Kaisers), sowie Schwert, Schild und heilige Lanze mit den dazugehörigen Kaiserornaten. Diese Isignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation befinden sich wohl noch heute in der Schatzkammer des ehemaligen „Allerhöchsten Kaiserhauses“ in Wien.
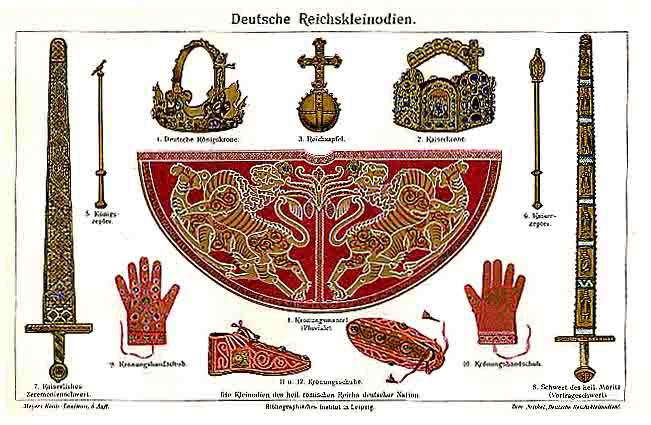
In der Hoffnung, daß auch unsere Stadt Fritzlar mit seinem historischen Rathaus aus dem 11. Jahrhundert, ähnlich wie die Städte Aachen, Frankfurt oder Goslar, sich dazu entschließt, diese deutschen Kaiser und Könige in Bild und Belegen zur Dauerausstellung zu bringen, um damit den Einheimischen wie den Besuchern die geschichtliche Bedeutung unserer Stadt ins Bewußtsein zu rufen.
H.J. HEER
Wochenspiegel Nr. 03/10, vom 16. Januar 1976, S. 1
DEUTSCHE KAISER UND KÖNIGE IN FRITZLAR
König Konrad 1. König von 911 bis 918
Die Hauptträger der karolingischen Politik in Hessen des 9. und 10. Jahrhunderts waren die Konradiner, die als karolingische Grafen nicht nur die üblichen Reichsrechte wahrnahmen, sondern auch in Fritzlar einen eigenen Verwaltungsmittelpunkt errichteten, der schon am Ende des 8. Jahrhunderts die Anfänge einer konradinischen Residenz erkennen läßt.
Damit war Fritzlar der bedeutendste Ort weit und breit geworden, wo das hessisch-konradinische Grafengeschlecht eine Villa besaß. Im Jahre 911 wurde der hessische Konradiner, Graf Konrad der Jüngere in Forchheim bei Bamberg zum deutschen König gewählt.
Vor der Königswahl trug er den Titel „Konrad, Herzog von Ostfranken, Hessen, Wetterau und Fritzlar, Fürst von Thüringen. So wurde die konradinische Villa in Fritzlar Königsvilla, königliches Kammergut, Königspfalz. Dies wird später ausdrücklich bezeugt.
Königspfalzen hatten in der Regel Pfalzkapellen, die dem hl. Johannes dem Täufer geweiht waren. Die alte Johanneskirche, die ehemals am Domplatz stand, ist wahrscheinlich als die alte Pfalzkapelle anzusehen, die uns zugleich den Platz der alten Kaiserpfalz in Fritzlar andeutet. Sie stand in der Nähe des heutigen Domes, westlich gegenüber dem Rathaus an der Nordostseite des Domplatzes.
Die Herrschaft Konrads I. sollte nur von kurzer Dauer sein. Nachdem er den mächtigen Sachsen-Herzog Heinrich zur Anerkennung seiner Königswürdegezwungen hatte, kämpfte er gegen die raubsüchtigen Feinde Deutschlands, die Ungarn, empfing aber in diesem Kriege eine schwere Wunde, an welcher er krank danieder lag. Als er nun die Nähe des Todes fühlte, berief er seinen Bruder Eberhard, der weder den Ruf der Tapferkeit, noch die Liebe und Zuneigung seines Volkes besaß, und redete ihm zu, der Regierung zu entsagen, die Reichskleinodien dem Herzog Heinrich von Sachsen zu überbringen und dessen Wahl zum König auf alle Weise zu fördern. Zu dem Ende sagte er zu Eberhard u. a.: „Täusche dich nicht, mein Bruder, über Dinge, von denen ich dir bisher, um dich nicht zu betrüben, noch nichts sagen mochte. Das Volk wünscht dich nicht zum König zu haben. Zwar kann unser Haus Heere ins Feld stellen; wir haben Städte und Waffen und sind im Besitze der Zeichen des Reiches, sowie alles dessen, was die königliche Würde verlangt. Nur das fehlt uns: Glück und persönliches Ansehen.“
So starb König Konrad I. nach nur achtjähriger Herrschaft am 23. Dezember 918. Der Tod dieses konradinischen Königs ist mit einer Handlung verknüpft, die seit jeher in der deutschen Geschichte als einzi-gartig gegolten hat, nämlich die Übergabe der Krone an seinen mächtigsten Gegner, Herzog Heinrich von Sachsen.
H.J.HEER

Wochenspiegel Nr. 04/10, vom 23. Januar 1976, S. 1
DEUTSCHE KAISER UND KöNIGE IN FRITZLAR
HEINRICH 1. König von 919 bis 936
Das historisch bedeutendste Ereignis in der 1250jährigen Geschichte Fritzlars ist zweifellos die Erhebung Heinrichs 1. zum König im Mai 919 durch die dort versammelten Franken und Sachsen. „Von da an“, bemerkte Otto von Freising, der größte Geschichtsdenker des deutschen Mittelalters, schon vor mehr als 800 Jahren in seiner Chronik „von da an rechnen manche dem Reich der Franken das der Deutschen“.
Hier in Fritzlar am Domplatz vor der Kaiserpfalz haben wir uns die weltgeschichtlichen Stätte zu denken, an der die Wahl des Sachsenherzogs Heinrich zum deutschen König erfolgte. Der sterbende König Konrad hatte nämlich hochsinnig nicht an sein Haus, sondern an das Reich gedacht und darum seinen Bruder Eberhard und die Großen, die das Lager umstanden, aufgefordert, um Spaltungen zu vermeiden, Herzog Heinrich von Sachsen, „den würdigsten und mächtigsten Fürsten", zum König zu wählen. Nach seinem Tode erfüllte Eberhard alsbald seines Bruders letzten Willen. Mit der Krone und den anderen Zeichen der königlichen Würde begab er sich zu Herzog Heinrich. Er traf ihn der Sage nach in Quedlinburg am Vogelherde, erzählte dem Staunenden seines Bruders Auftrag, fiel ihm zu Füßen und bot ihm Krone und Zepter an. Als Heinrich einwilligte, berief Eberhard mit Zustimmung der fränkischen und sächsischen Großen eine Reichsversammlung nach Fritzlar im Mai 919.

Dort lenkte er die Wahl auf Herzog Heinrich, welcher auch wirklich von den Sachsen und Franken zum König erwählt, und nachdem er die Würde angenommen hatte, als solcher ausgerufen wurde. Doch lehnte der neue König die ihm von dem Mainzer Erzbischof Heringer angebotene Krönung und Salbung mit der Äußerung ab: „Es genügt mir daran, höher zu stehen als meine Vorfahren und durch Gottes Gnade und euer Vertrauen König zu heißen; Salbung und Diadem mögen Würdigere empfangen.“
Herzog Eberhard, dem der Verzicht auf die Krone gewiß nicht leichtgefallen ist, und König Heinrich haben sich ebenso respektiert, wie das umgekehrt vorher König Konrad mit Herzog Heinrich getan hatte. Auch der neue deutsche König Heinrich I. hat zweifellos das ihm gebrachte Opfer in aller Form anerkannt und den fränkisch-hessischen Raum soweit wie möglich geschont und der Herrschaft Eberhards überlassen.
Diese einmalige Tat hatte überjahrhundertelang. deutsche Dichter u. Denker bewegt. So schrieb 1840 der Romantiker Joh. Nepomuk Vogl das bekannte Gedicht: Herr Heinrich sitzt am Vogelherd recht froh und wohlgemut; aus tausend Perlen blinkt und blitzt der Morgenröte Glut“. 1910 erschien das Schauspiel von Ernst von Wildenbruch „Der Deutsche König“, und 1925 die „Sonnenwende“ von Heinrich Winter, die alle das einmalige Thema beinhalten.
H.J.HEER
Wochenspiegel Nr. 05/10, vom 30. Januar 1976, S. 1
DEUTSCHE KAISER UND KÖNIGE IN FRITZLAR
Kaiser Otto 1. - genannt der Große - von 936 bis 973
Nachdem König Heinrich I. am 2. Juli 936 in der Pfalz zu Memleben die Augen schloß, übernahm sein Sohn Kaiser Otto I., genannt der Große, die Regierungsgewalt.
Er war der größte Herrscher des sächsischem Hauses, der sich mit der Macht des Königtums gegen die der Stammesherzogtümer durchgesetzt hatte. Durch die Unterwerfung Oberitaliens 951 und durch seine Kaiserkrönung in Rom 962 schuf er die weltgeschichtliche Verbindung Deutschlands mit Italien. Er war der Gründer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
In Fritzlar weilte Kaiser Otto 1. am 18. Januar 943. Bei ihm sind Erzbischof Friedrich von Mainz, Herzog Hermann und sein Bruder, der hl. Bruno, Erzbischof von Köln. Im Mai 953 hält er in der Kaiserpfalz zu Fritzlar einen Reichs- und Gerichtstag zum Abschlug eines in Dortmund gegen fürstliche Empörer eingeleiteten Verfahrens. Anwesend waren Herzog Heinrich, Erzbischof Friedrich von Mainz, Graf Dadi und Wilhelm. Konrad von Lothringen wird abgesetzt, die Grafen Dadi und Wilhelm gebannt, Herzog Heinrich zur Verwahrung übergeben. Auch Liudolf, der letzte hessische Graf, verliert auf diesem Reichstag Herzogtum und Lehen.
Vom 12. bis 16. Januar 958 finden wir Kaiser Otto I. abermals in Fritzlar. Auf die Fürsprache seines Bruders, des hl. Bruno von Köln, machte er eine Schenkung an das Kloster Meschede und an die Kirche zu Chur. Letztmals halten sich Kaiser Otto I. und sein Sohn Wilhelm, seit 954 Erzbischof von Mainz, für Jahre 959 in der Kaiserpfalz zu Fritzlar auf.

Vom 12. bis 16. Januar 958 finden wir Kaiser Otto I. abermals in Fritzlar. Auf die Fürsprache seines Bruders, des hl. Bruno von Köln, machte er eine Schenkung an das Kloster Meschede und an die Kirche zu Chur. Letztmals halten sich Kaiser Otto I. und sein Sohn Wilhelm, seit 954 Erzbischof von Mainz, für Jahre 959 in der Kaiserpfalz zu Fritzlar auf.
Dieser Kaiserbesuch hatte wohl für Hessen und Fritzlar eine Bedeutung von großer Tragweite. Er dürfte für Fritzlar ein Markstein in seiner Geschichte gewesen sein. Erzbischof Wilhelm war der Lieblingssohn des Kaiser Otto I., der ihm wiederholt Beweise seiner kaiserlichen Huld gab. Er hatte ihm das Reichs-Erzkanzleramt übertragen, das nunmehr mit dem erzbischöflichen Stuhle in Mainz verbunden blieb. Ergab ihm die weltliche Herrschaft über das Erfurter Land und auch, nachdem der letzte hessische Graf 953 abgesetzt war, die Grafschaft Hessen, die nun Mainz zunächst durch Wernerische und dann durch Gisonische Grafen verwalten ließ. Der Besuch Kaiser Otto I. und des Mainzer Erzbischofs Wilhelm in Fritzlar vom Jahre 959 sollte also wohl diesen wichtigen geschichtlichen Akt besiegeln.
Nun gehörte Fritzlar nicht bloß kirchlich, sondern auch staatlich zu Mainz und blieb mit den Dörfern Ungedanken und Rothhelmshausen, gleichwie die Ämter Naumburg, Neustadt und Amöneburg, bis zum Jalrre 1803 mainzisch, während die übrigen hessischen Gebiete mit der Zeit an das thüringisch-hessische Fürstengeschlecht fielen.
H.J.HEER
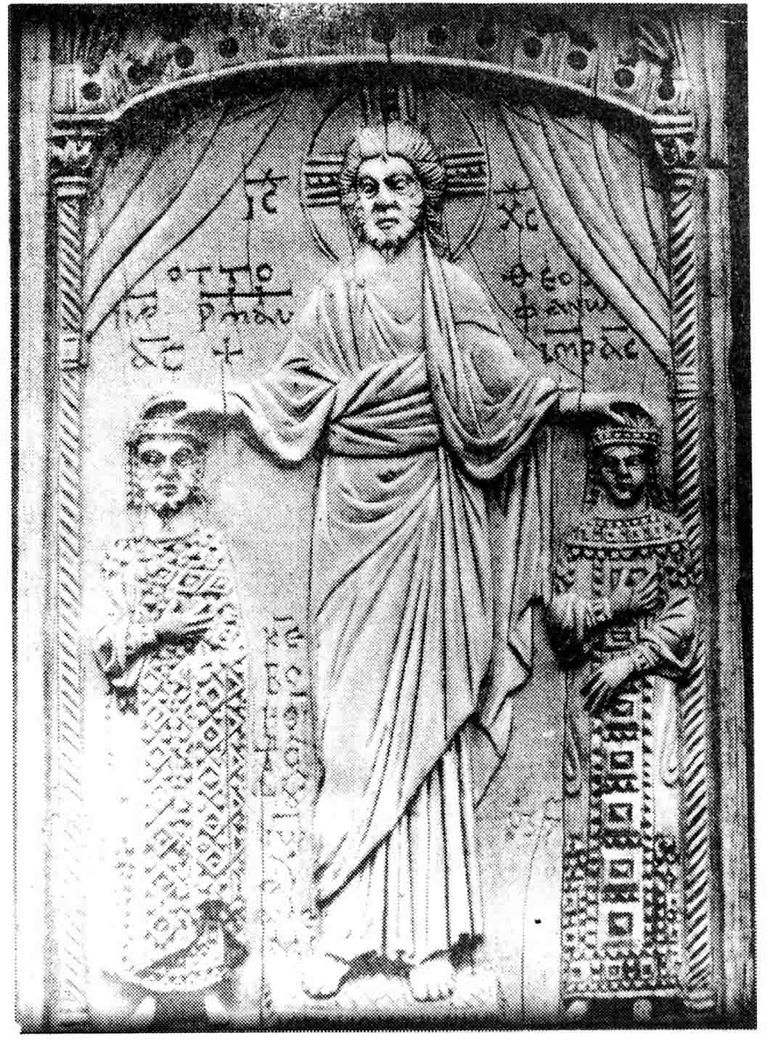
Auch Kaiser Otto 1. der Große war - wie sein Vater Kaiser Heinrich I. - in der Pfalz zu Memleben am 7. Mai 973 gestorben. Sein Grabmal befindet sich in dem von ihm gestifteten Dom zu Magdeburg.
Sein Sohn, Kaiser Otto II. übernahm 973 die Regentschaft. Er war von gelehrter Bildung, ging über die politischen Bestrebungen des Vaters hinaus, indem er die auf eine vollkommene Beherrschung des Mittelmeers zielende Politik der römischen Imperatoren und ihre Nachfolger wieder aufgriff. Italien sollte als zentrale Macht Südeuropas gleichberechtigt neben Deutschland treten. 961 zum König gewählt, 967 als Mitkaiser gekrönt, 972 mit der griechischen Prinzessin Theophano vermählt, hat er meistens in Italien gelebt.
Kaiser Otto II. ist wahrscheinlich urkundlich nur einmal in Fritzlar gewesen, und zwar wenige Tage nach der feierlichen Bestattung seines Vaters in Magdeburg, wo er von dort am 6. Juni 973 mit seinem Hofstaat aufbrach. In seiner Begleitung befand sich seine Mutter, die Kaiserin Adelheid, eine geborene Prinzessin von Burgund, und für unser Fritzlar von Bedeutung, ein arabischer Gesandter, von dem uns eine Schilderung über unsere Stadt vor 1000 Jahren überliefert wurde. Der Aufenthalt des Kaisers war nur kurz, die Reiseroute ging über die Pfalzen Werla, Grone und Fritzlar zu dem nach Worrns einberufenen Reichstag. Die in der Kanzlei des Kaisers zur Beurkundung in Fritzlar vorgenommene Schenkung wurde daher erst nach der Ankunft in Worms am 16. Juni vorgenommen.
Der Gesandte, Araber Ibrahim ibn Achmed at-Tartuschi, war im Auftrage des Kalifen Hakam II. im mohammedanischen Spanien nach Deutschland an den Hof Ottos I. und Ottos II. 973 gekommen. Welcher Art seine Mission war, wissen wir nicht genau. Es wird nur berichtet, daß er eine Menge kostbarer Geschenke für Kaiser Otto überbrachte und dieser ihm seinerseits Geschenke an seinen Herrn, den Kalifen, mitgab.
Tartuschi bereiste in Deutschland eine Reihe von Städten, von denen in den vorhandenen Textfragmenten noch folgende Namen erhalten sind: Schleschwiq (Schleswig), Itraht (Utrecht), Madifurg (Magdeburg), Schuschit (Soest), Magandscha (Mainz) und „Ifridislar", eine Arabisierung des Namens Fritzlar.
Hören wir nun, was er von seinem Besuch in Fritzlar zu berichten weiß:
„Ifridislar“, so beginnt Tartuschi, „ist eine feste Stadt in „Ifrandscha“ (Frankreich), deren Häuser aus Steinen erbaut sind. Sie wurde vor mehr als zwei Jahrhunder- ten von einem großen christlichen Märtyrer (Bonifatius 724) gegründet. In der Stadt befindet sich auch eine Kirche, die aus großen Steinblöcken errichtet ist und ein Kloster mit Mönchen. Ifridislar ist berühmt in den Frankenlande, weil hier die Infrandschin (Franken) und die Schäschin (Sachsen) vor einem halben Jahrhundert ihren ersten König gewählt haben“. (Heinrich I. 919)
Über die Bevölkerung und ihr Leben heißt es:
„Die Bewohner der Stadt sind alle Christen und verehren den Messias - Friede sei mit ihm! Sie gewinnen ihren Lebensunterhalt durch die Landwirtschaft, Handel und Handwerk. Sie sind fleißig und ehrlich, fromm und gläubig und besuchen oft in großer Zahl die erwähnte Kirche, um dort ihren Gott zu verehren.“
Er fährt dann in seinem Bericht fort:
„Die Leute wohnen dort in Häusern, deren Form verschieden von der unseren ist. Die Dächer sind spitz und nicht flach wie im Orient. Die Fensteröffnungen befinden sich an der Außenseite, so daß jeder ins Innere blicken kann, im Gegensatz zu unseren Häusern, deren Fenster an der Innenseite liegen. Die Umgebung von Ifridislar ist sehr fruchtbares Land. Ich sah dort Bäume, die Äpfel, Birnen und Pfirsiche trugen.“
Auch beschreibt er noch in sehr eigenartiger Weise das Klima und die Sauberkeit der Einwohner von Fritzlar.
H.J.HEER
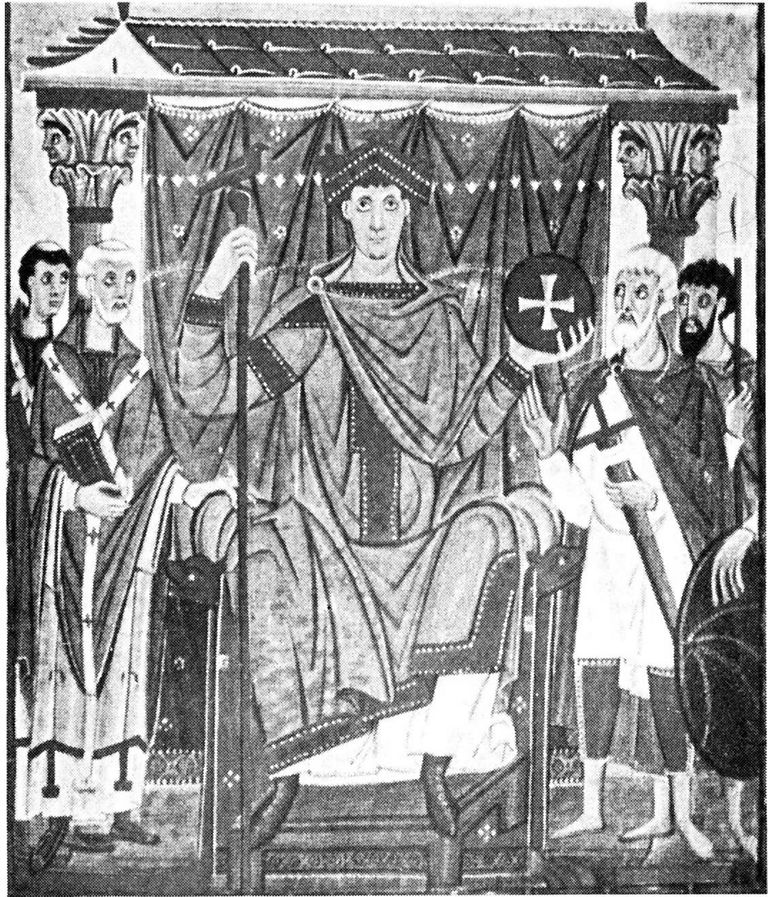
Sein Sohn, Kaiser Otto III., als Nachfolger war ein hochstrebender Jüngling von feiner und reicher Bildung, aber phantastisch, unpolitisch und unerfahren. Er nahm Rom zur Residenz und wollte von hier aus in Gemeinschaft mit dem Papst die Christenheit nach den Ideen des Gottesstaats regieren. Bis 994 unter der Vormundschaft seiner Mutter, der Kaiserin Theophano, und nach deren Tod dann seiner Großmutter, der Kaiserin Adelheid. Auf dem 1. Römerfeldzug machte er seinen Vetter Bruno zum Papst (Gregor V.), der ihn 996 im Alter von 16 Jahren zum Kaiser krönte.
Zu einem Aufenthalt Otto III., des vierten in der Reihe der Herrscher aus ottonischem Hause, kam es in Fritzlar nicht mehr. Doch wissen wir aus den Viten der beiden Hildesheimer Bischöfe Bernward und Godehard von dem Plan eines Hoftages, zu dem Otto III. die Fürsten für den Fall seiner Rückkehr aus Italien auf den 31. Mai 1002, den Sonntag nach Pfingsten, geladen hatte. Auf einen Fürstentag zu Frankfurt im August 1001 einigten sich Erzbischof Willigis von Mainz und Thangmar, der Vertreter Bischof Berwards von Hildesheim, den Gandersheimer Streit bis zu ihrem Erscheinen am 31. Mai 1002 vor dem Kaiser in Fritzlar ruhen zu lassen. Dieser Hoftag wurde am 27. Dez. 1001 auf der Synode zu Todi (in der italienischen Provinz Perugia) vor Kaiser und Papst gehaltene Rede für nach „Fridislare ad palatium“" (Kaiserplatz) festgelegt.
Jedoch der Tod Kaiser Ottos III. am 24. Jan. 1002 in der Burg Paterno in Sizilien macht den Hoftag in Fritzlar gegenstandslos. Es war das Ende eines jugendlichen Phantasten von 22 Jahren. Sein Grabmal befindet sich im Dom zu Aachen.
H.J.HEER
Wochenspiegel Nr. 08/10, vom 20. Februar 1976, S. 1-2
DEUTSCHE KAISER UND KÖNIGE IN FRITZLAR
Kaiser Heinrich II. der Heilige von 1002 – 1024
Mit Recht kann die Wissenschaft in der Geschichtsschreibung nur solche Forschungen anerkennen, die urkundlich belegbar sind. Leider sind über Besuche Kaiser Heinrich II. in Fritzlar noch keine urkundlichen Belege gefunden worden, trotzdem sprechen überzeugende Überlieferungen und besonders das kostbare Fritzlarer Kaiserkreuz im Domschatz für den Besuch dieses Kaisers. Für die Fritzlarer Geschichtsforschung über diese frühe Zeit, haben sich die großen Urkundenverluste bei den Zerstörungen 1079 und 1232 als besonders bedauerlich erwiesen. Andererseits muß man bei den urkundlichen Erwähnungen bedenken, daß sie über die Häufigkeit von Kaiserbesuchen in der Fritzlarer Pfalz nur eine sehr beschränkte Aussage machen können, denn selbstverständlich haben die Herrscher nicht jedesmal an jedem Ort, wo sie sich aufhielten, geurkundet.
Die Erwähnung einer Fritzlarer Generalsynode in der „Vita Haimeradi“ wird wissenschaftlich durchaus für möglich gehalten. Nach der Überlieferung soll sie 1020 in Fritzlar unter dem Vorsitz des Erzbischofs Erkenbald stattgefunden haben, auf dessen Konzil Kaiser Heinrich II. der Kirche zu Fritzlar das kostbare Vortragekreuz schenkte.nnen, denn selbstverständlich haben die Herrscher nicht jedesmal an jedem Ort, wo sie sich aufhielten, geurkundet.
Das romanische Vortragekreuz von etwa 48 Zentimeter Höhe und 29 Zentimeter Breite ist von der Kunstwissenschaft in das erste Drittel des II. Jahrhunderts datiert. Die Vorderseite ist mit 346 Edelsteinen in Goldfilet gefaßt, die alle das Mittelstück, einen großen, ovalen, durchsichtigen Bergkristall mit einem Kreuzpartikel vom „Kreuze Christi“ umrahmen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

7 Achate, 22 Almadin Granate, 46 Amethyste, 31 26 Chalcedone, 3 gebrannte Chalcedone, 16 Chrysopase, 3 Granate, 1 Labrador, 2 Nicolei, 1 Obsidian, 1 Onyx, 1 Plasma, 6 Saphire, 4 Wasser-Saphire, 1 Lux-Saphir, 1 Topas und 142 Perlen. 17 der Steine sind als griechische, römische und gallische Gemmen hervorzuheben. Wahrlich ein kaiserliches Geschenk.
Dieses kostbare Kreuz schmückte bei festlichen Gelegenheiten den Altar der Krypta, der dem hl. Kreuz geweiht war. Landgraf Ludwig III. (1172 - 1182) berichtet uns in einer Urkunde, daß dieses Kreuz in der Fritzlarer Krypta ihn und seine Gemahlin zu Tränen gerührt und ihn bestimmt habe, für diesen Altar eine Stiftung zu machen. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß Landgraf Ludwig III. eine solche Stiftung vorgenommen hätte, wenn ihm nicht bekannt gewesen wäre, daß dieses Kreuz eine Schenkung des 1146 heiliggesprochenen Kaiser Heinrich II. war.
Als weiterer Beweis, das Kaiser Heinrich II. in Fritzlar gewesen sein kann, muß die Tatsache gewertet werden, daß er fünf Mal das Kloster Kaufungen besuchte, eine Stiftung seiner Gattin Kunigunde, das letzte Mal am 22. Mai 1020, da es ja nicht weit von Fritzlar liegt.
Kaiser Heinrich II., der letzte der Sächsischen Herrscher, starb am 13. Juli 1024 ohne Leibeserben, sein Grabmal befindet sich im Dom zu Bamberg.
H.J.HEER

Kaiser Konrad II., der erste Salier auf dem deutschen Thron, war ein kraftvoller Herrscher. Er brachte Bayern, Schwaben und Kärnten an sein Stammhaus, sowie 1031 beide Lausitzen und 1034 Burgund an das Reich.
1027 wurde er zum Kaisergekrönt und war mit der Tochter Gisela des Herzogs Hermann II. von Schwaben vermählt.
Zum ersten Mal weilte Kaiser Konrad II. am 15. Juni 1028 in der Pfalz zu Fritzlar. Damals trat der kaiserliche Kapellan Hageno einige Güterstücke an Erzbischof Aribo von Mainz ab.
Es ist wahrscheinlich, daß der Kaiser bei seinem Reisezug von Aachen über Dortmund und Paderborn nach Magdeburg im Juni 1028 den Weg über Fritzlar einschlug.
Am 18. Januar 1032 weilte Kaiser Konrad II. auf seiner Fahrt von Paderborn nach Straßburg ebenfalls in der Pfalz zu Fritzlar. Im Gefolge des Kaisers befanden sich seine Gemahlin Kaiserin Gisela, sein Sohn, König Heinrich III. sowie die Bischöfe Meinwerk von Paderborn und Egilbert von Freising. Bei dieser Gelegenheit wurde in Fritzlar ein Diplom für das Bistum Paderborn ausgestellt.
Kaiser Konrad IIL verstarb am 4. Juni 1039 in Utrecht, er wurde in dem von ihm gestifteten Dom zu Speyer beigesetzt.
H.J.HEER
Wochenspiegel Nr. 10/10, vom 05. März 1976, S. 1
DEUTSCHE KAISER UND KÖNIGE IN FRITZLAR
Kaiser Heinrich III. von 1039 bis 1056
Kaiser Heinrich III., Sohn Konrads II., war einer der bedeutendsten und von höchsten Idealen getragener Herrscher. Unter seiner Herrschaftsführung hatte das Deutsche Reich seine größte Ausdehnung erhalten. Er brachte Ungarn in seine Abhängigkeit und schob die Grenzen des Reiches bis zur Leitha vor.
Er beseitigte 1046 das Schisma (die Kirchenspaltung; durch die Synoden von Sutri und Rom und brachte 4 deutsche Bischöfe auf den päpstlichen Thron (Klemens II., Damasus II., Leo IX. und Viktor II.). 1027 war er Herzog von Bayern, 1028 wurde er zum König und 1046 zum Kaiser gekrönt. Seine erste Gemahlin war Gunhild, Tochter Knuts des Großen, dänischer König, zugleich König von England und Norwegen, seine zweite Gemahlin Agnes von Poitou.
Heinrich III. war erstmalig als junger König mit seinen kaiserlichen Eltern am 18. Januar 1032 in der Pfalz in Fritzlar. Im Laufe seiner mehr als 17jähri-gen Regierungszeit ist Kaiser Heinrich III. noch dreimal in Fritzlar nachzuweisen: im Juli 1040, als sich der Hof auf dem Wege von der Pfalz Trebur nach Goslar befand.

Bei diesem Besuch in Fritzlar wurde in Anwesenheit des Königs, der Bischöfe von Speyer, Paderborn und Como sowie vier genannter Grafen ein Streit geschlichtet wegen der strittigen Zehnten zwischen Erzbischof Bardo von Mainz und der Äbtissin Hildegard über das von der hl. Kaiserin Kunigunde gegründete Frauenkloster Kaufungen bei Kassel.
Vertreten wurde das Kloster durch den Bischof Theoderich von Metz, dem Bruder der hl. Kaiserin Kunigunde. Der sogenannte Hessenzehnte des Klosters Kaufungen wird als zu Recht bestehend anerkannt, und zur Ablösung desselben werden einige Kaufunger Güter an Mainz abgetreten, und zwar Holzheim, Udenborn, Dorla, Nassenerfurth und das Gut Gensungen. Am 7. Dezember 1046 schenkt Kaiser Heinrich III. in Fritzlar auf Fürsprache seiner Gemahlin dem Erzbischof Balduin in Salzburg ein Gut Liutoldesdorf. Am 2. August 1047 macht Kaiser Heinrich III. in Fritzlar dem hessischen Frauenkloster Hilmarshausen an der Weser unter der Abtissin Swanehild seinen Grundbesitz in der benachbarten Villa Scheden zum Geschenk.
Kaiser Heinrich III. starb am 5. Oktober 1056 in der Pfalz zu Bodfeld im Harz, sein Grabmal befindet sich im Kaiserdom zu Speyer.
H.J.HEER
Wochenspiegel Nr. 11/10, vom 12. März 1976, S. 1-2
DEUTSCHE KAISER UND KÖNIGE IN FRITZLAR
Kaiser Heinrich IV. von 1056 bis 1106
Heinrichs III. Sohn war Kaiser Heinrich IV., der von allen deutschen Herrschern sich am häufigsten in Fritzlar aufgehalten hat. Deutscher König seit 1056, römischer Kaiser seit 1084.
Erstmals treffen wir den noch nicht sechzehnjährigen jungen König in Fritzlar Mitte Mai 1066. Da wurde er schwer krank. Die Ärzte gaben ihn auf, die Fürsten berieten bereits über die Reichsnachfolge. Am Krankenlager weilten der Landesherr von Fritzlar, Erzbischof Siegfried 1. von Mainz, sein Weihbischof, der Propst von Fritzlar, und Graf Ekbert. Die jugendlich kräftige Natur Heinrichs siegte über seine schwere Krankheit. Geheilt verließ er Fritzlar, um in Tribur Hochzeit mit Bertha von Turin (Savoyen). zu feiern.
Acht Jahre später, am 22. März 1074, erschien Heinrich IV. abermals in Fritzlar, wo er dem Markgrafen Ernst auf seine Bitte innerhalb seiner Mark Ostreich 40 Hufen im Walde Raabs schenkte.
Der große Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum war entbrannt, der sogenannte Investiturstreit. Schon die Vorgänger Heinrichs IV. hatten selbständig und ohne Zutun der Kirche kirchliche Stellen, besonders Bischofs- und Abtssitze, besetzt. Solange sie dazu tüchtige Männer wählten, hatte Rom geschwiegen, umsomehr, da es ein gewisses Mitwirkungsrecht der Krone bei der Besetzung dieser Stellen deshalb anerkennen mußte, weil Bischöfe und Äbte damals vielfach zugleich Landesherren waren. Als aber Heinrich der IV. soweit ging, daß er eine Geld- und Günstlingswirtschaft einführte, konnte die Kirche nicht länger schweigen. Kaiser Heinrich IV., damals 24 Jahre alt, kümmerte sich nicht darum, besetzte nach wie vor die erledigten Bischofssitze und ließ sogar am 24. Januar 1076 auf der Synode von Worms den Papst für abgesetzt erklären. Der. Papst erwiderte mit dem Bann des Kaisers, der deshalb verhängnisvoll für diesen war, weil er damit nach damals geltendem Rechte seinen Thron verloren hatte. Durch diesen Bann wurde Kaiser Heinrich IV. in der Geschichte als Canossa-Kaiser bekannt.
Papst Gregor VII. suchte durch Friedensverhandlungen die heillose Spaltung zu beseitigen, und diese Friedensverhandlungen zwischen Papst und Kaiser einerseits und zwischen dem 1077 zum Gegenkönig gewählten Rudolf von Schwaben andererseits sollten zum Teil in Fritzlar stattfinden. Jetzt wurde noch mehr als bisher in Fritzlar die Weltgeschichte zur Ortsgeschichte. Papst Gregor VII. hatte einen Legaten nach Deutschland zwecks Friedensherstellung gesandt. Diese Versammlung wurde nach Fritzlar berufen und trat hier 1078 zusammen. Außer dem päpstlichen Legaten waren die sächsischen Großen und vertraute Ratgeber des Kaisers erschienen, an ihrer Spitze Erzbischof Udo von Trier, des Kaisers Wortführer und Unterhändler. Die sächsischen Großen, Feinde Kaiser Heinrich IV., waren sehr ungehalten darüber, daß kein Reichsfürst sich eingefunden hatte, so wurde nur eine vorläufige Einigung, ein Burgfriede, erzielt.

Heinrich IV. hegte noch immer die Hoffnung, sich selber ohne Vermittlung mit seinen Gegnern auf friedlichem Wege auseinandersetzen zu können. Und wirklich kam es in der Fastenzeit 1079 zu einer erneuten Friedensversammlung in Fritzlar. Abgesandte von beiden Parteien waren erschienen. Die Gesandten des Königs baten die Sachsen, sie möchten sich fügen und unterwerfen, der König würde dann alles vergessen und ihnen gewogen sein. Die Sachsen bestanden darauf, der König solle zuerst den Willen zum Frieden zeigen und dem Papst Gehorsam leisten. Als die Vertreter des Königs darauf erklärten, ihr Herr und auch sie kümmerten sich wenig um Frieden und Papst, löste sich die Versammlung wieder auf. (Danach entbrannte über Fritzlar ein schreckliches Geschehen, der Gegenkönig greift in die Geschichte ein.)
Der deutsche Gegenkönig Rudolf von Schwaben war 1080 gefallen und Papst Gregor VII. war 1085 gestorben. In demselben Jahre erschien Heinrich IV. wieder in Fritzlar, wo ihn sein Freund, Bischof Udo von Hildesheim, aufs neue seiner Treue und Unterwürfigkeit versicherte.
Zu Beginn des 12. Jahrhunderts finden wir Heinrich IV. zum letzten Mal in unserer Stadt. Mit einer Heeresmacht war er anfangs Dezember 1104 vom Rhein gekommen, um sich am Grafen Dietrich von Sachsen zu rächen. In seiner Begleitung befand sich sein Sohn, der bereits 1098 zum König gewählte spätere Heinrich V. Hier in Fritzlar, wo Heinrich IV. vor 38 Jahren als Schwerkranker mit dem Tode gerungen, hier sollte das an Bitternissen so reiche Leben dieses unglücklichen Kaisers den Höhepunkt der Tragik ereichen. Hier in der Kaiserpfalz zu Fritzlar erfolgten die Flucht, der Abfall und die Empörung Heinrichs V. gegen seinen Vater.
Am 7. August 1106 starb Kaiser Heinrich I V. in Lüttich, sein Grabmal befindet sich im Kaiserdom zu Speyer.
H.J.HEER

Rudolf von Schwaben wurde zum deutschen Gegenkönig in Forchheim am 15. März 1077 gewählt, er hat nur drei Jahre regiert und starb nach seiner siegreichen Schlacht über Kaiser Heinrich IV. bei Hohenmölsen 1080, sein Grabmal mit kunstvoller Bronzeplatte befindet sich im Dom zu Merseburg.
Die gescheiterten Friedensverhandlungen und der Bann über Kaiser Heinrich IV. brachten den Gegenkönig Rudolf von Schwaben an die Regierungsmacht. Der Gegenkönig Rudolf von Schwaben hatte gegen Ende Januar 1079 eine ansehnliche Truppenmacht in Sachsen gegen den Kaiser zusammengezogen. Als die Fastensynode zu Fritzlar ergebnislos verlaufen war, brach der Sturm los. Rudolfs Heer suchte zunächst Westfalen, das mehr zu Heinrich neigte, schwer heim, dann zog es südwärts durch das Hessenland und erschien vor Fritzlar. Denn Heinrich war nach der Fastensynode selber nach Fritzlar gekommen. Der Chronist Gerstenberg erzählt: „Der Keyßer floch und enthilt sich zu Fritzlar. Da das der Herzog Rudolf vernahm, da tzoch er vor Fritzlar unde verbrannte die stad mit sente Bonifacius monster allerdinge, unde geschach auch große schade dem lande zu Heßen an fruchten. Da floch der Keyßer vorters an den Ryn.“
Das Frühjahr 1079 brachte also wahre Schreckenstage über Fritzlar. Kirche, Stift und Stadt wurden von Rudolf und dem sächsischen Heere den Flammen preisgegeben. Sie müssen damals fürchterlich hier gehaust haben, denn der Mainzer Erzbischof Wezilo, der sechs Jahre später das Trümmerfeld von Fritzlar besuchte, schrieb im Jahre 1085: „Als ich an den Ort kam, der Fritzlar heißt, fand ich das Münster von den Sachsen verbrannt, das Kloster völlig zerstört vor. Überall Trümmer und Leichen.“
Die Verwüstung in Fritzlar hielt den Gang der Verhandlungen nicht auf. Schon im Sommer des Jahres 1079 beriefen die päpstlichen Legaten zur dritten Friedensverhandlung in Fritzlar ein. Der Kaiser und der Gegenkönig waren geladen, dazu Welf sowie die sächsischen und schwäbischen Fürsten. Der Gegenkönig Rudolf und die sächsischen Fürsten erschienen, die anderen Geladenen, so hieß es, seien von Heinrich von der Tagung abgehalten worden.
Wohl aber war sein Vertreter zur Stelle, der Patriarch Heinrich von Aquileja. Dieser, sowohl wie auch die päpstlichen Legaten, Kardinalerzbischof Petrus und Bischof Udalrich, wurden von dem gleichfalls anwesenden geistlichen Landesfürsten Siegfried I. von Mainz festlich empfangen.
Der Gegenkönig Rudolf von Schwaben, der mit den sächsischen Fürsten zu Papst Gregor VII. hielt, sah den Zweck der Tagung darin, die Ursache der Zwistigkeiten sachlich und gerecht zu untersuchen und bestand darauf, Heinrich müsse nunmehr sichere Garantien geben, daß er sich den Festsetzungen des Fritzlarer Tages fügen werde. Man endigte die Tagung, als die Vertreter Heinrichs die befriedigende Erklärung abgaben, daß sie, wenn nötig, Heinrich zwingen würden, die aufgestellten Forderungen zu erfüllen.
H.J.HEER
Wochenspiegel Nr. 13/10, vom 26. März 1976, S. 1-2
DEUTSCHE KAISER UND KÖNIGE IN FRITZLAR
Kaiser Heinrich V. von 1106 bis 1125
Der letzte Salier war kühn und energisch, aber verschlagen - Realpolitiker. Deutscher König 1106 - 1111, römischer Kaiser 1111 - 1125, vermählt mit Mathilde, der Tochter Heinrichs I. von England, gestorben am 23. Mai 1125 in Utrecht, Grabmal im Kaiserdom zu Speyer. Heinrich V. war kinderlos und hatte seinen Neffen, den Staufer Friedrich II. von Schwaben, zum Nachfolger ersehen.
Heinrich V., Heinrich IV. Sohn! Ein weltgeschichtliches Drama mit Schuld und Sühne. Fritzlar sollte die Bühne dieses Dramas sein. Es war in der Nacht des 12. Dezember 1104, da verließ Heinrich V. heimlich mit seinem Freunde Hermann von Wingenburg und anderen Vertrauten die Kaiserpfalz in Fritzlar und begab sich nach Bayern in das Lager der Feinde seines Vaters, um mit ihnen gemeinsame Sache zu machen.

Die Flucht und der Verrat seines Sohnes, das war wohl der größte Schmerz und die bitterste Enttäuschung im Leben Heinrichs IV. Tief erschüttert gab er am nächsten Tag sofort sein Unternehmen gegen die Sachsen auf. Schon sein erster Sohn Konrad hatte sich gegen ihn erhoben, die erste Ehe mit Berta war unglücklich gewesen, seine zweite Gemahling Praxedis hatte ihn verlassen, und nun erhob sich auch sein zweiter Sohn Heinrich gegen ihn. Das brach ihm das Herz. Am 7. August 1106 stand es zu Lüttich still. Ein unglückliches Leben hatte geendet.
14 Jahre später. Nach seiner Thronbesteigung zeigte Heinrich V. sich als Sohn seines Vaters. Innerlich der Kirche fremd, kümmerte er sich nicht um das Investiturverbot und vergab wie sein Vater Bistümer und Abteien. Wie sein Vater erschien er auch in Rom, ließ Papst und Kardinäle gefangen nehmen und zwang den Papst, ihm für die Besetzung von Bistümern und Abteien Zugeständnisse zu machen. Allein das Blatt wandte sich bald. 1115 war er von den Sachsen geschlagen worden, die seine Feinde geblieben waren, wie sie es seinem Vater gewesen. Vor Allerheiligen 1115 waren sie dann unter dem Vorsitze des Kardinals Dietrich in Fritzlar zusammengekommen, um selbständig ohne das Reichsoberhaupt über Reichsangelegenheiten zu beraten.
Für den 28. Juli 1118 hatte der päpstliche Legat Kuno von Präneste abermals eine Synode nach Fritzlar ausgeschrieben. Sie war glänzend besucht. U. a. waren zugegen: Erzbischof Adalbert von Mainz und Erzbischof Friedrich von Köln, ferner die Bischöfe Godebald von Utrecht und Bruno von Speyer, außerdem aus Sachsen vier Bischöfe: Dietrich von Münster, Gottschalk von Osnabrück, Arnold von Merseburg und Dietrich von Naumburg.
Die erste Handlung dieser glänzenden Versammlung war der Baunn über Kaiser Heinrich V., über den von ihm aufgestellten Gegenpapst und alle ihre Anhänger. In Fritzlar hatte er sich gegen seinen Vater vor 14 Jahren empört, in Fritzlar traf ihn auch der Bann. Geschichte und Gericht!
H.J.HEER
Wochenspiegel Nr. 14/10, vom 02. April 1976, S. 1
DEUTSCHE KAISER UND KÖNIGE IN FRITZLAR
König Konrad III. von 1138 bis 1152
Der erste Hohenstaufe als König 1138 auf deutschem Thron, Neffe Kaiser Heinrich V., war ein fröhlicher umgänglicher Mann und ein tüchtiger Territorialpolitiker. Als König vermehrte er die fränkischen Besitzungen der Familie im Nürnberger Gebiet durch die Ehe mit Gertrud von Sulzbach, kam 1149 vom zweiten Kreuzzug krank zurück und starb am 15. Februar 1152, sein Grabmal befindet sich im Dom zu Bamberg.
Die Menge der Reichs- und Kirchenversammlungen in Fritzlar, die unter den sächsischen Kaisern Heinrich IV. und Heinrich V. ihren Höhepunkt erreicht hatten, ebbten allmählich ab.
Ende August des Jahres 1145 traf König Konrad III., anläßlich der Weihe des Augustiner-Chorherrenstiftes Weißenstein bei Kassel mit Erzbischof Heinrich von Mainz in Fritzlar zusammen. Das Kloster Weißenstein war eine Gründung des Fritzlarer Kanonikers Bubo von Fritzlar, 1143 Magister beim Chorherrenstift.
Dann schließt die Reihe der Fritzlarer Tagungen mit drei großen Kirchenversammlungen. Eine Provinzialsynode hielt hier Erzbischof Siegfried III. von Mainz am 30. Mai 1243, in der der Bann über Kaiser Friedrich II. verhängt und Statuten über Ausspendung der Sakramente und die Kirchenzucht erlassen wurden.

Zwei weitere Synoden fanden in den Jahren 1246 und 1259 in Fritzlar statt, die sich mit kirchlichen Aufgaben befaßten.
11 Könige und Kaiser haben vom 10. bis 12. Jahrhundert die Geschicke des großen römischen Reiches deutscher Nation zum Teil bei 23 urkundlich nachweisbaren Aufenthalten in der Pfalz in Fritzlar gelenkt. Sicherlich sind die Herrscher noch weit öfter in Fritzlar gewesen, denn die Urkundenverluste aus der frühen deutschen Geschichte sind groß und nicht jeder Besuch wurde beurkundet.
Darum möchte ich die Herrscherbesuche mit dem Abschlußsatz aus dem Festvortrag „Königsstadt Fritzlar“ von Oberstaatsarchivrat Dr. K. E. Demandt aus Marburg beschließen, der da lautet: „Wenden wir den Blick noch einmal Abschied nehmend unserer aus dem Morgenlicht der deutschen Geschichte herüber grüßenden Königsstadt Fritzlar zu und schließen mit den Worten der Dichtung: `Erinnerung und Hoffnung: Was vergangen, kehrt nicht wieder, aber ging es leuchtend nieder, leuchtet's lange noch zurück.´"
H.J.HEER
Wochenspiegel Nr. 15/10, vom 9. April 1976, S. 1-2
„DER ROTE HALS“ - NORDEINGANG AM DOM ZU FRITZLAR
Ein Beitrag zur Klärung des seltsamen Namens
An der Nordwand des Fritzlarer Domes, gegenüber des Treppenaufganges zum Rathaus, befindet sich in Gestalt eines Windfanges ein wieterer Zugang zum Dominneren mit dem eigenartigen Namen „Der rote Hals“. Mit der Deutung dieses seltsamen Namens haben sich in den letzten hundert Jahren viele Forscher befaßt.
Die erste baugeschichtliche Beschreibung des Domes, von Heinrich von Dehn-Rotfelser, Kassel 1864, in Sonderdruck „Die Stiftskirche St. Petri zu Fritzlar“. Bei seiner Beschreibung der Nordwand des Seitenschiffes schreibt Dehn-Rotfelser auf Seite 19 folgendes:
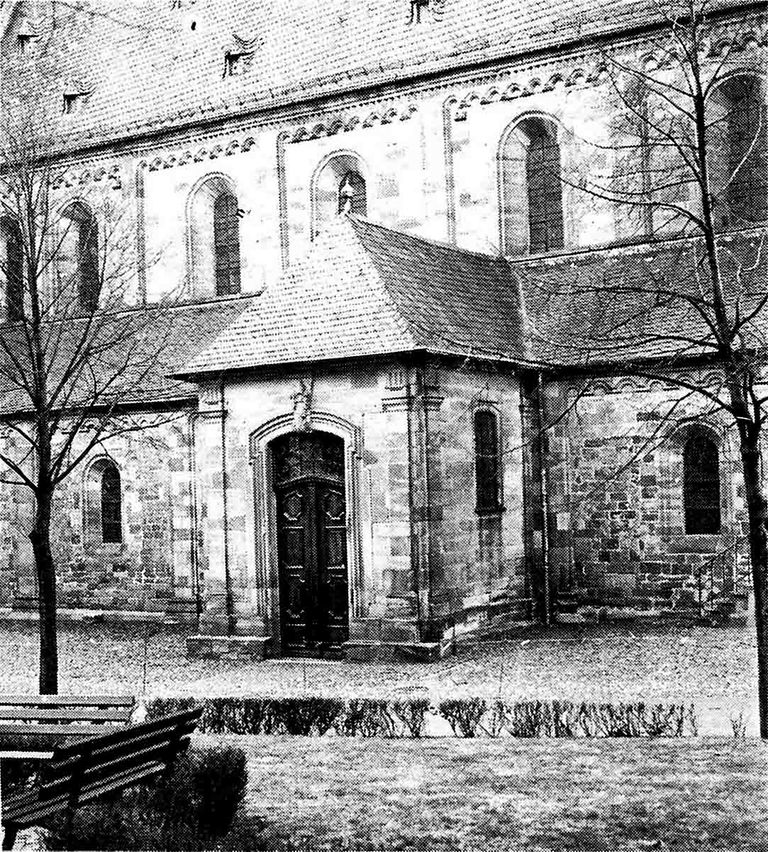
„An der Stelle des fünften Fensters befindet sich jetzt eine im Rundbogen überwölbte, rechtwinklig eingeschnittene Tür, vor welcher ein Vorbau in Renaissance-Form angebaut ist, über dessen Eingang sich unter dem erzbischöflichen Wappen die Jahreszahl 1735 eingehauen findet.
Dieser Vorbau führt den sonderbaren Namen ,Der rothe Hals´. Er ist mit einem rippenlosen Kreuzgewölbe überdeckt und enthält eine Treppe, welche von dem sehr erhöhten äußeren Boden in die Kirche ´hinabführt“. 22 Zeilen weiter unten schreibt er:
„Ob westlich vom rothen Hals Lisenen und Bogenfries an der Seitenschiffmauer vorhanden waren, erscheint zweifelhaft, da zwischen dem rothen Hals und dem sechsten Fenster keine Spur von einer etwa abgearbeiteten Lisene zu finden ist und noch weniger am Anschluß der alten Seitenschiffmauer an den Thurm eine Spur sich zeigt. Wahrscheinlich rührt dieser Theil der Seitenschiffmauer aus der frühesten Zeit des Baues her, in welcher eine Ausstattung des Seitenschiffes mit Lisenen und Bogenfries noch nicht beabsichtigt war“.
C. Alhard von Drach schreibt in seinen „Bau- und Kunstdenkmäler im Reg. Bezirk Kassel, Band II Kreis Fritzlar, 1909“ folgendes: S. 56 - 57:
„Vor dieser Nordwand befindet sich heute noch 'der rote Hals' als Windfang für den darin befindlichen Eingang in die Kirche; es ist ein 1735 in antikisierenden Barockformen errichteter quadratischer Vorbau mit je einem Fenster auf beiden Seitenwänden und einem oben mit dem Stiftswappen und der Jahreszahl versehenen Portal auf der Nordseite.
Das Innere ist mit einem rippenlosen Kreuzgewölbe überdeckt, letzteres war bis zu der vorher erwähnten Veränderung der Nordwand des Seitenschiffs auch an dieser weitergeführt.
(An vielen Quaderstücken des heutigen Baues findet sich ein altes Steinmetzzeichen in Gestalt eines römischen A.)
Es erübrigt noch, den seltsamen Namen, der von einem früher hier befindlichen Anhängsel der Stiftskirche sich auf den neueren Bauteil übertragen hat, zu erklären. In der „Fabrikrechnung des Jahres 1548“ kommen Anstreicherarbeiten „am rothen halse“ vor, es werden verrechnet 7 1/2 alb. und 3 hlr., „wofür am rothen halse die thuer geschwartzt und das maurnwerg weis und roith angestrichen“. Ein Beweis für das Vorhandensein eines so genannten Baues schon zu jener Zeit; klar wird die Sache jedoch erst dadurch, daß in der „Fabrica de annis 1659/60“ zu lesen ist: „Im rothen hals St. Johannis haupt ahnzumachen dem steinmetz geben 42 Schillinge“. Es war also in dem alten Durchgang eine Skulptur oder Gemälde von dem Haupt Johannis des Täufers mit der blutig rot gemalten Schnittfläche des Halses als Schlußsteinverzierung oder an der Wand zu befestigen.
Christian Rauch, schreibt in seinen Kunstgeschichtlichen Führer „Fritzlar“, 1926, S. 34 folgendes:
„Der Vorbau vor dem Nebenschiff, der als Windfang dient, im Volksmunde der rote Hals genannt, hat klassizistische Barockformen und ist durch eine Inschrift über der Tür auf 1735 datiert. Seinen Namen soll dieser Bauteil von einem nicht mehr vorhandenen Bilde des blutigen Hauptes Johannes des Täufers bekommen haben, aber vielleicht gibt der Sprachgebrauch des Volkes, das einen Vorbau als Hals bezeichnet „Kellerhals“ und die vorwiegende Verwendung roten Sandsteins eine näherliegende Erklärung.“
Volker Katzmann schreibt 1974 in „Fritzlar, die alte Dom- und Kaiserstadt und ihre Kunstschätze“ auf Seite 10 folgendes:
„Der kleinere Zugangsbau vor dem Nordeingang, der ,Rote Hals´, hat klassizistische beruhigte Barockformen, er ist über der Tür 1735 datiert. Der Name dieses Vorbaus wird auf eine Darstellung vom blutenden Haupt des Täufers Johannes zurückgeführt, die sich früher hier befunden haben soll, vielleicht erinnert er auch daran, daß die Hingerichteten dereinst an dieser Stelle des alten Friedhofs begraben worden sind.“
Diese verschiedenen Deutungen waren bis heute eine mögliche Erklärung zu den Namen „Der rote Hals“, jedoch hat der Forschungsbericht von den archäologischen Ausgrabungen über die Pfalz auf der Nordseite des Paderborner Domes in den Jahren von 1964 bis 1970, ein ganz neues Licht zu diesem Thema geliefert. Prof. W. Winkelmann schreibt in seinem Bericht „Die Frühgeschichte im Paderborner Land“ (Die Pfalz Paderborn) in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Band 20, Paderborner Hochfläche - Paderborn - Büren - Salzkotten. Unveränderter Nachdruck 1975, S. 99 bis 121.
Bei den Ausgrabungsarbeiten sind die Fundamente von den Pfalzbauten sowie der alte Rechtsplatz mit einem Thronunterbau zu Tage getreten. Winkelmann schreibt in seinem Forschungsbericht auf Seite 105 - 6:
„Das Ganze stellt den steinernen Unterbau für einen Thronsitz dar, der hier in der mittleren Achse der alten Anlage in zentraler Lage vor der Mitte der Ostwand des Pfalzhofes errichtet war. In die Mauerschlitze konnten, wenn dieser Platz in Funktion war, hölzerne Pfosten eingestellt werden, die einen Baldachin Überbau trugen, wie ihn mittelalterliche Miniaturen wiederholt darstellen.
Mit diesem steinernen Monument erhält die Pfalz in dieser historischen Stätte ein Herrschaftszeichen besonderer Bedeutunn: denn hiermit ist das solium wiedergefunden, das zweimal auch im Text des Epos zu 799 erwähnt wird: „Rex pius interea sulium conscendit“ - und „Ipse sedet solio Karolus rex iustus in alto danns leges patriis, et regni foedera firmat“.
Der Thronunterbau ist heute durch eine schmale Treppe an der Ostseite des großen Treppenpodestes vor dem Nordportal (Rote Pforte) des Domes zugänglich.
Auf eine ungebrochene Tradition dieses alten Rechtsplatzes weist das 2,5 m höher direkt über dem karlischen solium im frühen 13. Jahrhundert errichtete Nordportal des Domes, die Rote Pforte, es ist noch im 14. und 15. Jahrhundert als Rechtsplatz bezeugt. Unter dem Namen Rote Pforte oder Rote Tür sind auch unter anderem an den Domen zu Frankfurt, Magdeburg und Erfurt alte Rechtsplätze überliefert.
(wird fortgesetzt)
Wochenspiegel Nr. 18/10, vom 30. April 1976, S. 1-2
„DER ROTE HALS“ - NORDEINGANG AM DOM ZU FRITZLAR
Ein Beitrag zur Klärung des seltsamen Namens
Dieses Forschungsergebnis stellt auch für Fritzlar die berechtigte Frage, ob es sich bei dem „roten Hals“ am Nordausgang des Domes nicht ebenfalls um eine Gerichtspforte handelt. Prüft man in dieser Hinsicht die geschichtlichen Überlieferungen, so ergibt sich für das Gelände an der Nord- und Westseite am Fritzlarer Dom fast die gleiche rechtsgeschichtliche Situation wie in Paderborn.
C.B.N. Falckenheiner beschreibt uns 1841 in seinem Werk „Geschichte Fritzlar's“, Seite 426 - 28 im Zweitdruck 1925 folgendes:
„Die höchste Instanz bildete der Erzbischof, von welchem auch ,Gebot und Verbot´ ausging. Anfangs, als der Erzbischof regelmäßig seine Umreisen hielt, nahm er in eigener Person den, sonst dem Vicedom überlassenen Vorsitz in den Gerichtsversammlungen ein. Diese wurden überall an einem fest bestimmten Platz (mallum) gehalten, und hatten, als aus lauter Freien bestehend, auch nur über Freie zu richten; über Unfreie richtete der Vogt, als dessen Gerichtsplatz in Fritzlar schon 1109 das Vogteihaus (praetorium) genannt wird.
Das älteste mallum in Fritzlar lag da, wo wir es in den bei weitem meisten alten Orten finden, nämlich neben der Kirche. Es war hier der Friedhof (bei der Stiftskirche) dazu bestimmt worden und zu diesem Behufe, um den Richtern und der versammelten Menge Schutz gegen Regen, Schnee und Sonnenbrand zu gewähren, mit einem Bretterdach (testudo) überdeckt, nach den Seiten aber wahrscheinlich, wie alle ähnlichen Plätze, von bedeckten Gängen umgeben. Er hieß daher die Halle (atrium); auf ihm sprudelte ein Quell. Hier in der Halle sehen wir daher 1287 den Erzbischof Heinrich den Vorsitz einnehmen und den Vertrag mit Fritzlar wegen der Erbauung der Burg genehmigen.
Hier auf dem Kirchhofe tritt 1244 ein gemischtes Gericht aus Geistlichen und Rittern zusammen und entscheidet über eine Hufe Landes in Wabern; hier auf demselben ,Kirchhofe´, („acta sunt hec fritslar in Cimiterio Ecclesie Fritslariensis“) wird am 24. April 1315 der Verkauf Meiseburg'scher Güter in Lützelmaden an den Cantor Hermann von Grune durch die beiden Bürgermeister Stadt, deren Schöffen und den Notar (also die Gerichtsperson) beglaubigt. Hier, auf demselben Platze, sehen wir 1389 den Erzbischof Adolph von Mainz als Lehnsherren im Lehnsgericht dem Landgrafen Hermann die Lehen reichen. Selbst der den Hallen nie fehlende Quell oder Brunnen auf dem Fritzlar'schen Kirchhofe, welcher erst im vorigen Jahrhundert zugeworfen wurde, läßt sich urkundlich nachweisen. - Daß meine Ansicht von der Lage des alten Gerichtsplatzes und die hier gegebene Beschreibung desselben auf festem geschichtlichen Boden steht, und mehr als schwankende Muthmaßung ist, geht auch aus den unzweideutigen Worten einer ungr. Urk. d.d. 31. März 1463 hervor. Dort heißt es nämlich von dem kurz zuvor verstorbenen Fritzlarer Decan Johannes Kirchain:
„incendebat Remedium salutare quandam Capellam renouare et in eadem altare novum consttruere - ante foras ecclesie supradicte (S.Petri). ubi itur ad atrum Dictum Frithoff sub testudine Dicta sancte Elizabeth werg a parte dextra“ etc. - Von hier wurde der Gerichtsplatz erst nach 1400 (Denn noch 1440 Dienst. nach U.L.F. Tag assumpt. tritt auf dem Kirchhofe an der S. Peterskirche ein Compromißgericht zusammen, um über eingezogene Lehen in dem Dorfe Geismar zu entscheiden) auf den Marktplatz verlegt, (siehe meinen Aufsatz „Der Rolandsbrunnen, ein Rechtswahrzeichen aus Fritzlarer Vergangenheit“ Wochenspiegel vom 11.6.1971, 5. Jahrgang Nr. 24), und als endlich das öffentliche deutsche Recht wie allenthalben so auch in Fritzlar, von dem römischen nun ganz und gar verdrängt wurde, auf die engen Rathhausstuben mit ihren Acten-Reposituren beschränkt.
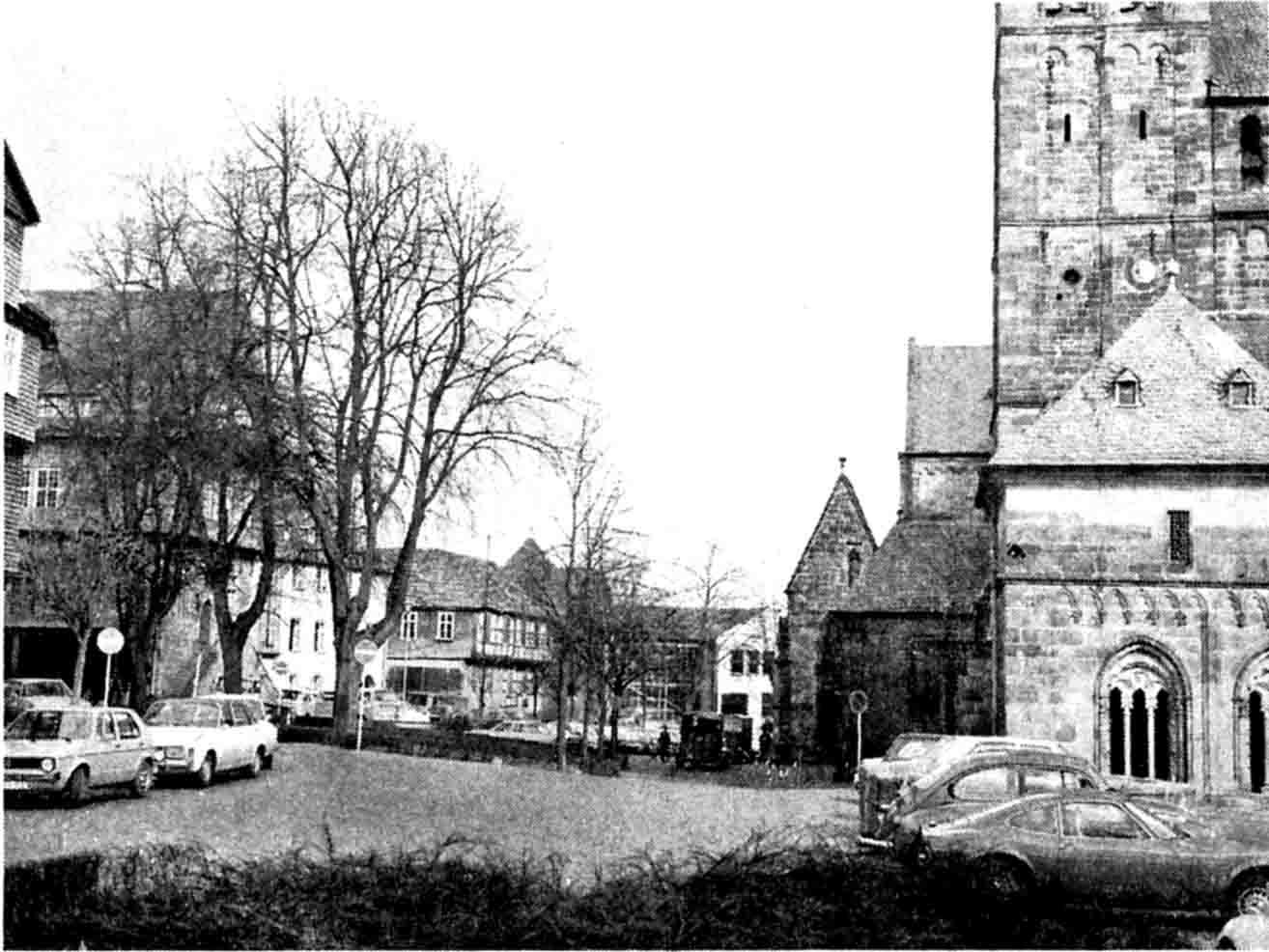
Wir sehen also, daß in Fritzlar fast dieselben Anlagebedingungen wie in Paderborn vorliegen, und der Name „roter Hals" als Gerichtspforte vom Dom zum Rechtsplatz hinweist. Von Entscheidung für das Alter der Deutung des Namens „roter Hals" sind zwei Dinge, erstens die Tatsache, daß die Mauerteile an der Stelle der Nordseite des Domes wo sich der rote Hals befindet zu den Ältesten am Bauwerk gehören und die Tatsache von dem Vorhandensein des alten Rechtsplatzes, der wahrscheinlich schon in vorgeschichtlicher Zeit als Thingstätte diente. Der seltsame Name „Roter Hals“ oder „Rote Pforte“ bezeichnet nichts anderes als den Zugang zum „rode land“ der alten niedersächsischen Bezeichnung der Blutgerichtsstätte. Eine archäologische Gesamtgrabung würde wohl Klärung des geschichtsträchtigen Gelände am heutigen Jestädt- und Domplatz ergeben, denn kleinere Grabungen erbrachten schon verschiedene Hinweise. So unter anderen von W. Stock, „Gesammelte Bemerkungen über die Lage der Konradinischen Burg zu Fritzlar“, mit drei Skizzen, ein handschriftlicher Aufsatz vom Jahre 1909, K. Becker, „Ausgrabungen im Dom in Fritzlar“, Zeitschrift die Denkmalpflege, 21. Jhrg. 1919, mit einer Geländezeichnung, sowie von F. Osswald, „Die bauliche Entwicklung des Fritzlarer Domes nach den Untersuchungen von 1969“, mit der Beilagekarte Nr. 3, in der Festschrift zur 1250-Jahrfeier „Fritzlar im Mittelalter“. Die letzte Grabung ergab ebenfalls Hinweise vom ältesten Steinbau am roten Hals, wo auch die bis jetzt älteste Fritzlarer Münze aus der Zeit König Otto 1. 936-62 am 4.6.1970 gefunden wurde.
Es wäre somit denkbar, bei der großen geschichtlichen Vergangenheit Fritzlars, daß auf diesem alten Rechtsplatz, 919 die Wahl König Heinrich 1. durch die versammelten Franken und Sachsen stattgefunden hat, aber auch die Reichsversammlungen wo hier 1118 über Kaiser Heinrich V. und 1243 über Kaiser Friedrich II. der Bann verhängt wurde, wo 11 deutsche Könige und Kaiser tagten und zahlreiche Kirchensynoden ihre Tagungen hatten. An der Grenze zwischen dem fränkischen und sächsischen Reich, war Fritzlar mit seiner Pfalz und seiner alten Rechtsstätte, wo sich 23 König- und Kaiserbesuche 300 Jahre lang nachweisen lassen, ein Ort großer deutscher Vergangenheit.
Fritzlar, den 28. Jan. 1976 Hans Josef Heer
Der „Graue Turm“ zu Fritzlar war nicht nur der größte unter den 19 Wehrtürmen der mittelalterlichen Stadt-Befestigungsanlage, sondern gehört er auch zu den mächtigsten Wehrtürmen Deutschlands, welcher noch unsere Zeit überdauert hat. Seinen Namen „Grauer Turm“ (grae turn) oder auch „Großer Turm“ (turis magna) hat er wohl durch den noch an vielen Stellen vorhandenen graugelben Bewurf und seiner Größe erhalten.
Er wird zuerst 1274 erwähnt, der hufeisenförmige Unterbau, dessen gerade Seite 10,5 m mißt, ist jedoch älter, in diesem befindet sich ein 7,2 m hohes Verließ in Kuppelform mit Angstloch, welches als Stadtgefängnis diente. Laut Inschrift wurde im Jahre 1541 durch die Stadtmauer eine Seitentür in dies Verließ gebrochen, der eisenbeschlagene Flügel mit Schiebeschloß und Eisenring ist noch heute vorhanden.
Zu dem ersten Stockwerk gelangt man von dem in ganzer Breite hinter dem Turm auf der Stadtmauer herlaufenden Wehrgang durch eine oben mit Traufgesims abgedeckte Eichentür.
Der Turm erhebt sich zu 35 m Höhe im Steinbau, zunächst waren dem mit der Stadtmauer gleichhohen Unterbau nur drei Stockwerke, jedes von etwa 4 m Höhe, aufgesetzt worden. Der obere Abschluß dieses Baues läßt sich sehr leicht auf der geraden Stadtseite des Turmes an einem schrägen Mauerabsatz, sowie an dem Beginn eines anderen Steinformats erkennen. In diesen drei Geschossen sind überall die gleich einfachen Schießschlitze mit Falzen an der Schartenenge fit Prellhölzer der Nackenbüchsen, im untersten Stockwerk ist auf der südlichen Seite auch auf Konsolen ein vorgekragter steinerner Abtritt, was darauf schließen läßt, daß der Turm einer ständigen Besatzung zum Aufenthalt diente, also gewissermaßen ein Wohnturm war.
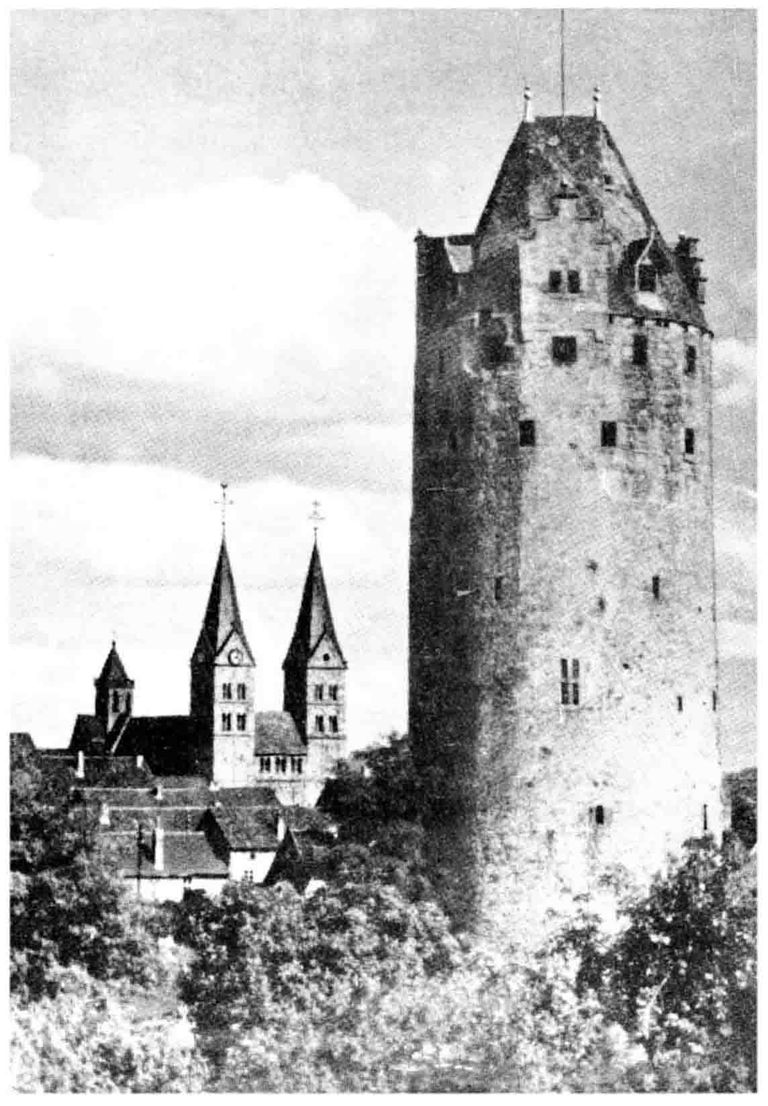
Er bildete nämlich die Signalstation für die sieben auf der Grenze des Fritzlarer Stadtgebietes stehenden Warten und wurde wohl hauptsächlich wegen dieses Gebrauches im 16. Jahrhundert nochmals bedeutend aufgestockt. Von den beiden damals aufgesetzten Geschossen hat der untere nach außen zu sechs große Rechteckfenster in großer Stichbogenblenden und drei ebensolche auf der Stadtseite. Oberhalb der letzteren ist eine Türöffnung und darunter stehen noch vier Kragsteine aus der Mauer hervor, die wahrscheinlich bestimmt waren, einen hölzernen Aufbau mit Aufzug zu tragen
Die Veranlassung zum Baue dieses mächtigen Turmes hat folgende geschichtliche Ursache: Das Schicksal der ältesten nachweisbaren Fritzlarer Stadtbefestigung wurde im September 1232 besiegelt, als Landgraf Konrad von Thüringen im Verlaufe seiner Auseinandersetzung mit Erzbischof Siegfried III. von Mainz die hartnäckig verteidigte Stadt erstürmte.
Er ließ Mauern und Türme niederbrechen, wie nicht nur chronikalisch überliefert, sondern auch aus dem baulichen Befund der nördlichen Stadtmauer ersichtlich ist.
Vor allem aber besitzen wir auch verschiedene urkundliche Nachrichten über die Neuerrichtung der Befestigung, die sofort wieder in Angriff genommen worden ist, denn bereits 1233/34 einigten sich Stadt und Petersstift über den Betrag von 30 Pfund Geldes zum Baue der Mauern. Nach fünf Jahren angestrengter Bautätigkeit war der Neubau der Stadtbefestigung im wesentlichen abgeschlossen, wie aus zwei Urkunden des Jahres 1237 hervorgeht.
Mit der Neuerrichtung der Stadtmauer wurden die Mauertürme der Nord- und Ostseite als die gefährdetste Stelle des Verteidigungsringes als erste ausgebaut. Der Jordansturm, der Greben- und Rosenturm, von welchen die beiden letzteren schon dem 12. Jahrhundert angehören. Vollendet aber war der Schutz der gefährdeten Nordseite der Stadt erst nach der Errichtung des „Grauen Turmes“ an der nordwestlichen Ecke der Stadtmauer.
Staatsarchivrat Dr. Demandt schreibt darüber 1974 in einem Aufsatz „Die mittelalterliche Befestigung Fritzlars“ im Jubiläumsband der Festschrift zur 1250-Jahrfeier folgendes: „Dieser offensichtlich in einem Zuge erbaute, etwa halbkreisförmige Turm, dessen gerade Seite 10,5 m mißt, erhebt sich zu einer Höhe von 35 m im Steinbau und stellt einen der mächtigsten deutschen Stadtbefestigungstürme überhaupt dar. Auch er ist noch im 13. Jahrhundert aufgeführt worden.
Eine urkundliche Nachricht vom Jahre 1274, nach der das Stift 20 Pfund Geld zum Bau eines Turmes beigetragen hatte, ist wohl nur auf den großen Turm beziehbar. Die Summe ist im Vergleich zu dem 40 Jahre vorher zum gesamten Mauerbau beigesteuerten Betrag von 30 Pfund für einen einzelnen Turm so unverhältnismäßig hoch, daß es sich hier um ein außerordentliches Werk gehandelt haben muß.
Als solches kommt für diese Zeit aber allein der Graue Turm in Betracht.“
Fortsetzung folgt. Hans Josef Heer
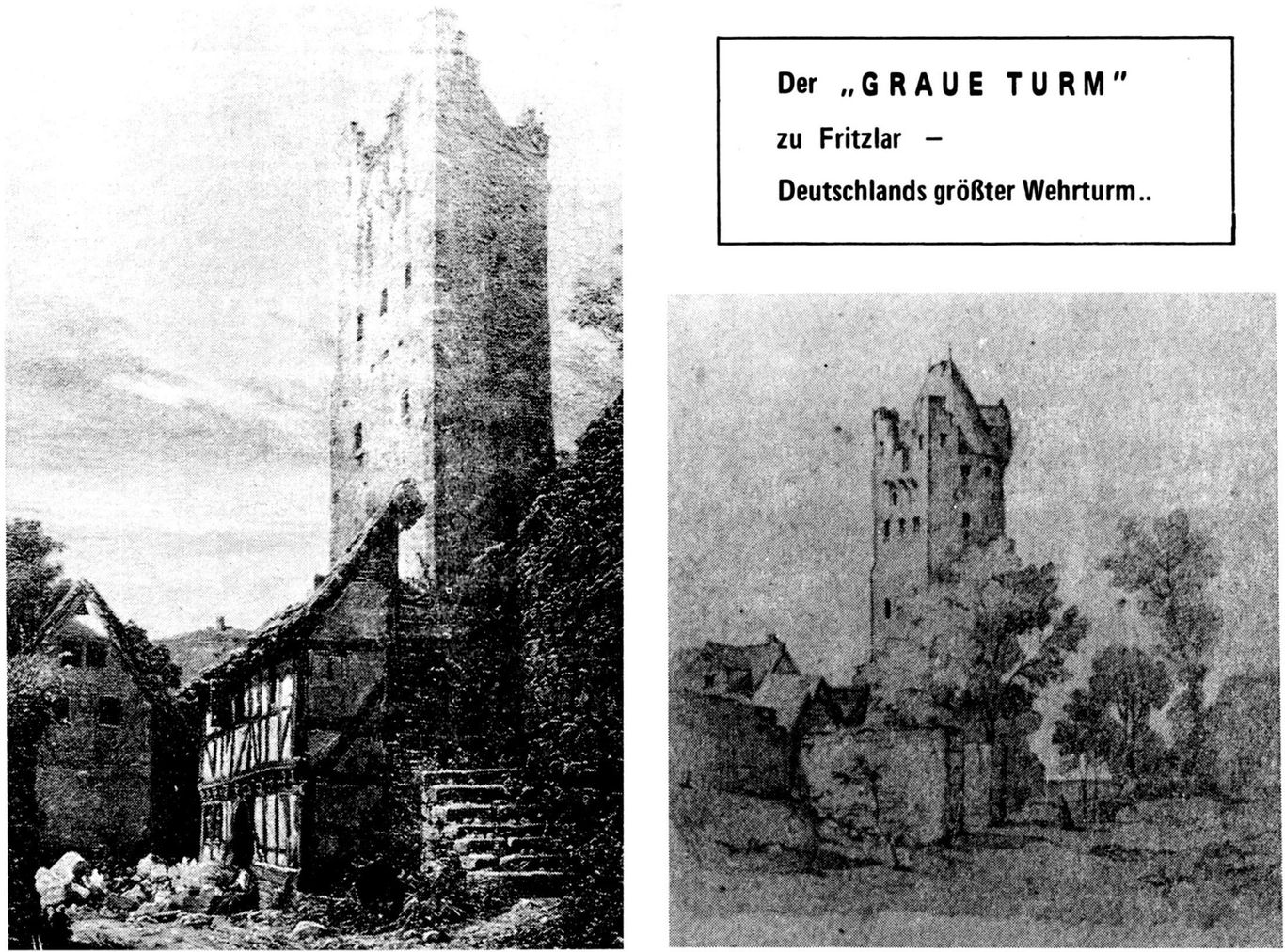
DER „GRAUE TURM“ ZU FRITZLAR, DEUTSCHLANDS GRÖSSTER WEHRTURM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fortsetzung
Nachdem im 15. Jahrhundert das Wartensystem um Fritzlar vervollständigt wurde, hatte man noch im Anfang des 16. Jahrhunderts den „Grauen Turm“ um zwei Stockwerke erhöht, damit wurde er zur Signalstation für die Warten und der gesamten Festungsanlage hergerichtet, und unter dauernde Besetzung mit Wachmannschaften gehalten. In den vielen Fehden zwischen Hessen und Mainz, aber auch noch im 30jährigen Krieg hatte Fritzlar, dank seiner vorzüglichen Wehranlage lange nicht so viel zu leiden gehabt wie fast alle anderen Städte in Hessen. Fritzlar trug in damaliger Zeit mit Recht den zusätzlichen Namen „urbs turritica“, die turmreiche Stadt, denn sie hatte außer ihren 10 Kirchtürmen, 23 Stadttürme und sieben Warttürmen, zusammen also ein Stadtbild mit 40 Türmen.
Grunddessen zählte Fritzlar auch zu den schwer einnehmbaren Städten wie etwa: Nürnberg, Bamberg, Augsburg oder Rothenburg ob der Tauber. Jedoch wurde seine Wehranlage nach dem 30jährigen Kriege vernachlässigt und konnte den immer stärker werdenden Feuerwaffen im 7jährigen Kriege nicht mehr standhalten. So liest man bei Falckenheiners „Geschichte Fritzlars“ 1841 wie folgt: „Bis in den Juni 1762 blieben die Franzosen im Besitz Fritzlars und räumten dann die Stadt freiwillig, nachdem sie in ihr noch ein trauriges, bis auf unsere Zeiten sichtbares Denkmal sich - durch Zerstörungen gegründet hatten. Der Graf von Rochembeau erhielt mit seiner Brigade den Befehl, die Festungswerke Fritzlars zu schleifen. Der Befehl wurde nur zu gut vollführt. Die Brustwehren der starken Mauern, die noch vor einem Jahre den deutschen Kugeln getrotzt und die Franzosen geschützt hatten, wurden niedergebrochen, die alten bemoosten Türme, an denen so manches Jahrhundert vorübergegangen war, deren Zahl unserem Fritzlar ein so stattliches Ansehen gab, und deren Höhe und Stärke von seiner ehemaligen Kraft und seinem Reichtum Zeugnis gab, sie sanken größtenteils unter der zerstörenden Hand der Fremdlinge. Sogar der unschuldige trockene Graben über dem Haddamartor wurde verschüttet.
Es war, als ob die durch den Krieg ausgesogene, bettelarm gemachte Stadt nicht einmal mehr einer sichtbaren Erinnerung an bessere Zeiten sich sollte erfreuen dürfen.“
Fritzlar hat im siebenjährigen Kriege, der am 15. Febr. 1763 durch den Frieden von Hubertusburg beendet wurde, schrecklich gelitten. Die Zahl der Bürger war von 550 auf 190 zurückgegangen.
Doch seine Lebenslinie stieg wieder aufwärts. 1829 zählte die Stadt schon wieder 436 Bürger mit 2.632 Einwohnern.
Aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind uns noch zwei schöne Bilder des Grauen Turmes erhalten geblieben, dessen Künstler zum Kreis der „Romantischen Maler“ von Hessen zählen. Fin Ölgemälde des Malers J. Ickler vom Jahre 1839 und eine Pinselzeichnung vom Maler August von Wille, beides Bilder im Besitz der Staatlichen Kunstsammlung Kassel. Abbildung und Besprechung erfolgt in der letzten Fortsetzung.
Im Sommer 1874 besuchten Ihre königlichen Hoheiten, der Kronprinz Wilhelm mit seinem Bruder Prinz Heinrich unsere Stadt. Kronprinz Wilhelm äußerte dem sie begleitenden und führenden Bürgermeister Kraiger den lebhaften Wunsch, daß der Graue Turm wieder in seiner früheren Gestalt hergestellt werden sollte. Jedoch sollten noch 15 Jahre vergehen, ehe dieses Vorhaben in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Die Ereignisse werden uns in einem köstlichen Amtsdeutsch wie folgt überliefert: „1888 am 9. März schied aus Seinem glorreichen Leben Kaiser Wilhelm 1. ihm folgte sein ritterlicher Sohn Friedrich auf den Thron. Infolge eines schweren Leidens (Kehlkopfkrebs) schied die königliche Eiche am 15. Juni 1888 aus diesem Leben. Nach dem Tode Kaiser Friedrichs III. trat sein Sohn als Kaiser Wilhelm II, die Regierung an. 1889, auf Veranlassung des Herrn Ministers der geistlichen Angelegenheiten wurde der „Graue Turm“ wieder hergestellt und mit einem neuen Dache versehen. Das alte Dach war im Jahre 1859, weil reparaturbedürftig, einfach abgenommen worden. Die Kosten der Wiederherstellung betrugen 4.630 Goldmark.“
Damals erhielt der Graue Turm in vier Etagen gedielte Balkenböden, die dann mit Leitern zu besteigen waren.
1882 erfolgte der Abbruch der alten Stadtmauer von etwa 10 m Höhe und 30 m Breite am Grauen Turm, um vom Marktplatz am Hochzeitshaus vorbei durch den Burggraben direkt zum Zimmerplatz zu gelangen.
1925, anläßlich der 1200-Jahrfeier der Stadt Fritzlar, trat erstmalig die Planung auf, den Grauen Turm mit seinen vielen Etagen als altes Wahrzeichen aus Fritzlars Glanzzeit für eine Jugendherberge auszubauen. Der damalige Stadtbaumeister Reuter entwarf die Baupläne, jedoch an der schwierigen Wirtschaftslage unserer Stadt, nach dem verlorenen 1. Weltkrieg, konnte dieses Projekt nicht verwirklicht werden.
Schluß folgt. Hans Josef Heer
Wochenspiegel Nr. 27/10, vom 2. Juli 1976, S. 1-2
DER „GRAUE TURM“ ZU FRITZLAR, DEUTSCHLANDS GRÖSSTER WEHRTURM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Fortsetzung
Seine größte Feuerprobe erlebte der schon fast 700 Jahre alte Recke im 20. Jahrhundert, vom 30. März bis 1. April 1945 bei der Einnahme unserer Stadt durch die Soldaten der Neuen Welt. Die amerikanischen Einheiten beschossen ihn mit schweren Panzer-Granaten, in dem Glauben, daß die bedachten Türme unserer Stadt den deutschen Soldaten als Beobachtungsposten dienten. Außer dem Grauen Turm wurde der Bleichenturm, der Steingossenturm, der Regilturm und der Frauenturm beschossen. Wenn auch die Letzteren in der Hauptsache ihre alten Dächer verloren, so hatte der Graue Turm doch mehrere schwere Mauereinschläge erhalten, so daß sein Bestand für die Zukunft gefährdet war. Auch erstürmten, nach der Einnahme Fritzlars, amerikanische Soldaten den Grauen Turm. Sie erbrachen den unteren Eingang und gelangten über die Leitern in die einzelnen Stockwerke. Sie hielten ihn längere Zeit besetzt und haben sich noch heute sichtbar durch Einschnitzen ihrer Namen und Wohnorte des amerikanischen Kontinents verewigt.
Nachdem nun 1954 durch die großzügige Stiftung zweier Fritzlarer Söhne, die Brüder Karl und Franz Seibel, Fabrikanten in Erwitte, gemeinsam mit der Stadt den Bestand des Grauen Turmes mit einem Kostenaufwand von ca. 14.000 DM durch Ausbesserungen der Einschlagstellen und des Daches sowie durch Zementspritzungen erhalten hatten, trat erstmalig der Plan auf, diesen großen und hohen Turm für friedliche Zwecke nutzbar zu machen.
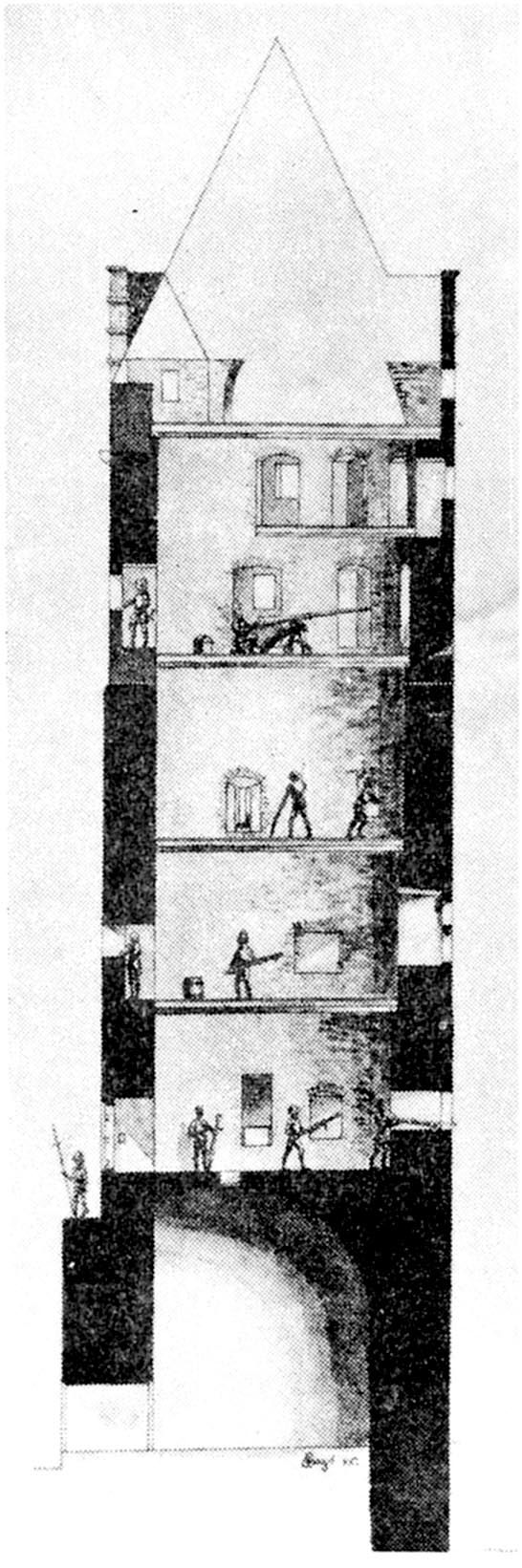
Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein Fritzlar hatte diesbezüglich wiederholte Anträge an die verschiedenen Stellen wie Stadt, Kreis und Fremdenverkehrsverband Kurhessen und Waldeck gestellt, welche auch Erfolg hatten. Die Stadt Fritzlar stellte durch ihren Stadtbaumeister Eckert die benötigten Baupläne sowie Baumaterial und Basaltsteine kostenlos, der Kreis bewilligte die Pläne und überwies zusätzlich eine Summe von 500 DM, der Fremdenverkehrs-verband vermittelte über das Land liessen aus Lottomitteln die Summe von 2000,- DM.
1958 kam es dann zum ersten größeren Bauabschnitt. Die 10 Meter hohe Stadtmauer bis zum oberen Eingang des Grauen Turmes wurde von außen durch eine Basaltsteintreppe mit 42 Stufen erschlossen. Die schöne Außentreppe hatte damals die Baufirma K. Balke, trotz der vorhandenen geringen Barmittel für ihre Heimatstadt erstellt. Das schmiedeeiserne Treppengeländer ist eine Arbeit der Schlosserei O. Anders.
1962 gab das Stadtparlament seine Zustimmung zum Gesamtausbau des Grauen Turmes mit einem Kostenaufwand von über 30.000,- DM. In zweijähriger Bauzeit wurden alle Etagenböden in Eisenbeton gegossen und mit 90 Betonstufen ersteigbar gemacht, die ebenfalls mit schmiedeeisernen Geländern versehen wurden, damit es jedem noch halbwegs rüstigen Einwohner oder Besucher unserer Stadt möglich ist, den Turm über 131 Stufen zu ersteigen. Im obersten Aussichtsturm, von etwa 6 Meter Höhe, sind 18 große Fernsichtfenster vorhanden, wobei die neun oberen Fenster durch eine eingebaute Zwerggalerie erreichbar sind.
Zwischen den Fenstern an der Innenmauer wurden vom Verkehrs- und Verschönerungsverein eine Geschichtstafel des Turmes und Wappen des Landes Hessen, des Kreises Fritzlar-Ilomberg und seinen Städten -im Raume verteilt- angebracht.
Zur 1250-Jahrfeier unserer Stadt und zum 700jährigen Bestehen des „Grauen Turmes“ wurde 1974 das Gelände um den Turm in würdigem Zustand hergerichtet. Die große Gartensteinfläche vor der Stadtmauer, die noch einen zusätzlichen Ausgang durch die Stadtmauer erhielt, war damals der Zeltplatz für die vielen kulturellen Festveranstaltungen. Im Grauen Turm selbst war in den unteren Räumen erstmalig eine Kunstausstellung von Gemälden und Graphiken im Stil unserer Zeit.
Deutschlands größter Wehrturm hat nun seine volle Festigkeit wiedererlangt. Wenn nicht neue Kriegseinwirkungen oder gar Erdbeben seinen Bestand gefährden, kann er in Zukunft als Aussichtsturm und zum Zwecke kultureller Belange genutzt werden, um nochmals weitere 700 Jahre -etwa im Jahre 2700- kund zu tun von der großen Vergangenheit unserer Stadt Fritzlar.
Mögen darum die Einwohner und Besucher unserer Stadt wenigstens einmal im Jahr die Gelegenheit nutzen, diesen Aussichtsturm zu ersteigen, um sich mit ihren Kindern an der Schönheit unseres Hessenlandes zu erfreuen.
Hans Josef Heer
Wochenspiegel Nr. 33/10 vom 13. August 1976, S. 1-2
Fritzlar in der Zeit der Romantik I
Im heutigen Zeitalter der atomaren Technik mit seiner hektischen Automation überkommt uns Menschen bei der Betrachtung und Lesung von Bildern und Schriften des vergangenen Jahrhunderts eine Sehnsucht nach der einfachen „Genügsamkeit", der Romantik und des Biedermeier. Eine der interessantesten Vertreterin um die Wende des 19. Jahrhunderts war zweifellos Bettina Brentano, die den Romantiker Achim von Arnim heiratete. Bettina von Arnim, die Verfasserin von „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde“, wurde am 4. April 1785 als Drittjüngstes Kind aus der Ehe des Kaufmanns Peter Anton Brentano mit der von Goethe hochverehrten Maximiliane von Laroche in Frankfurt am Main im „Goldenen Kopf“ in der Sandgasse geboren. Nach dem Tode der beiden Eltern wurde sie mit ihren drei Schwestern gegen Ende des 18. Jahrhunderts vier Jahre lang als Zögling in dem Kloster der Ursulinen zu Fritzlar erzogen, worüber sie in ihrem bekannten obengenannten Buch an Goethe schreibt:
„In den hängenden Gärten der Semiramis bin ich erzogen, ich glattes, braunes, feingegliedertes Rehchen, zahm und freudig zu jedem Liebkosenden, aber unbändig in eigentümlichen Neigungen.
-Oben im ersten und höchsten Garten stand die Klosterkirche auf einem Rasenplatz, der am felsigen Boden hinab grünte und mit einem hohen Gang von Trauben umgeben war; er führte zur Türe der Sakristei. In dieser Türwölbung saß ich manchen heißen Nachmittag, links in der Ecke des Kreuzbaues das Bienenhaus unter hohen Taxusbäumen, rechts der kleine Bienengarten, bepflanzt mit duftenden Kräutern und Nelken, aus denen die Bienen Honig saugten. In die Ferne konnte ich da sehen; die Ferne, die so wunderliche Gefühle in der Kinderseele erregt, die ewig eins und dasselbe vor uns liegt, bewegt in Licht und Schatten, und zuerst schauerliche Ahnungen einer verhüllten Zukunft in uns weckt; da saß ich und sah die Bienen von ihren Streifzügen heimkehren; ich sah, wie sie sich im Blumenstaub wälzten und wie sie weiter und weiter flogen in die ungemessene Ferne, wie sie im blauen, sonnendurchglänzten Aether verschwebten, und da ging mir mitten in diesen Anwandlungen von Melancholie auch die Ahnung von ungemessenem Glück auf. -
Von dem Kirchgarten führte eine hohe Treppe, über die das Wasser schäumend hinabstürzte, zum zweiten Garten, der rund war, mit regelmäßigen Blumenstücken ein großes Bassin umgab, in dem das.Wasser sprang; hohe Pyramiden von Taxus umgaben das Bassin, sie waren mit purpurroten Beeren übersäet, deren jede ein krystallhelles Harztröpfchen ausschwitzte; ich weiß noch alles, und dies besonders war meine Lieblingsfreude, die ersten Strahlen der Morgensonne in diesen Harzdiamanten sich spiegeln zu sehen. -
Das Wasser lief aus dem Bassin unter der Erde bis zum Ende des runden Gartens, und stürzte von da wieder eine hohe Treppe hinab in den dritten Garten, der den runden Garten ganz umzog, und grad so tief lag, daß die Wipfel seiner Bäume wie ein Meer den runden Garten umwogten. Es war so schön, wenn sie blühten, oder auch wenn die Aepfel und die Kirschen reiften und die vollen Aeste herüberstreckten.
Oft lag ich unter den Bäumen in der heißen Mittagssonne, und in der lautlosen Natur, wo sich kein Hälmchen regte, fiel die reife Frucht neben mir nieder ins hohe Gras; ich dachte: „Dich wird auch keiner finden!“ Da streckte ich die Hand aus nach dem goldenen Apfel und berührte ihn mit seinen Lippen, damit er doch nicht gar umsonst gewesen sein solle.
-Nicht wahr, die Gärten waren schön! - zauberisch! Da unten sammelte sich das Wasser in einem steinernen Brunnen, der von hohen Tannen umgeben war; dann lief es noch mehrere Terrassen hinab, immer in steinerne Becken gesammelt, wo es dann unter der Erde bis zur Mauer kam, die den tiefsten, alle anderen Gärten umgebenden einschloß, und von da sich ins Tal ergoß, denn auch dieser letzte Garten lag noch auf einer ziemlichen Höhe; da floß es in einem Bach weiter, ich weiß nicht wohin. So sah ich denn von oben hinab seinem Stürzen, seinem Sprudeln, seinem ruhigen Lauf zu; ich sah, wie es sich sammelte und kunstreich emporsprang und in feinen Strahlen umherspielte; es verbarg sich, es kam aber wieder und eilte wieder eine hohe Treppe hinab; ich eilte ihm nach, ich fand es im klaren Brunnen von dunklen Tannen umgeben, in denen die Nachtigallen hausten; da war es so traulich, da spielte ich mit den bloßen Füßen in dem kühlen Wasser.“
Ein Märchenbuch liegt über dieser poesievollen, naturfrohen Schilderung, in der Bettina, Dichtung und Wahrheit anmutig mischend, des Paradieses ihrer Kindheit gedenkt. So kann man auch verstehen wenn Goethe schreibt:
„Deine Briefe, allerliebste Bettine, sind von der Art, daß man jederzeit glaubt, der letzte sei der interessanteste. So ging's mir mit den Blättern, die Du mitgebracht hattest, und die ich am Morgen Deiner Abreise fleißig las und wieder las. Goethe“
Kein geringerer als der General-Inspektor der Fürstlichen Gärten zu Kassel und Wilhelmshöhe, Wunsdorf, hatte aus Dankbarkeit fur die Erziehung seiner zwei Töchter den von Bettina geschilderten schönen Klostergarten angelegt.
Hans Josef Heer
Wochenspiegel Nr. 34/10 vom 20. August 1976, S. 1-2
Fritzlar in der Zeit der Romantik II
„Du wunderliches Kind, Bettine und Goethe“, trägt der Titel eines Buches von Alfred Kantorowicz, wo er unter anderem in einem Vorwort schreibt: „Sie muß unwiderstehlich gewesen sein, die junge Bettine; ihr Zauber ergreift uns in ihren Briefen wieder, frisch, als stünde sie vor uns in ihrem Ungestüm, ihrer Begeisterungsfähigkeit, ihrer Einfühlsamkeit, ihrem Spürsinn für das, was groß und echt und wertbeständig war in ihrer Zeit. „Die Freundin bedeutender Männer“ nannte man sie im Kreise vornehmer Dichter, Denker und Künstler des 19. Jahrhunderts.
Die bedeutendsten ihrer Zeitgenossen haben Bettines Zauber gehuldigt; Schleiermachers schönes Kompliment: „Gott müsse bei besonders guter Laune gewesen sein, als er Bettine erschaffen habe“, setzt das Maß für die heitere Wertschätzung, die die Großen der Zeit Goethes ‚Kind‘ entgegenbrachten.“
Am 8. August 1808 schreibt Bettine in einem langen Briefe an Goethe unter anderem folgende herrliche Geschichte aus der Fritzlarer zeit: „Alle Blumen habe ich geliebt, eine jede in ihrer Art, wie ich sie nacheinander kennen lernte, - ich will sie nicht nennen alle, mit denen ich so innig vertraut wurde, wie sie mir jetzt im Gedächtnis erwachen; nur eines einzigen gedenke ich, eines Myrthenbaumes. den eine junge Nonne dort pflegte. Sie hatte ihn winters und sommers in ihrer Zelle; sie richtete sich in allem nach ihm; sie gab ihm nachts wie tags die Luft, und nur so viel Wärme erhielt er im Winter, als ihm not tat. Wie fühlte sie sich belohnt, da er mit Knospen bedeckt war ! Sie zeigte mir sie, schon wie sie kaum angesetzt hatten; ich half ihn pflegen; alle Morgen füllte ich den Krug mit Wasser am Mädchenbrünnchen; die Knospen wuchsen und röteten ich, endlich brachen sie auf; am vierten Tag stand er in voller Blüte; eine weiße Zelle jede Blüte, mit tausend Strahlenpfeilen in ihrer Mitte, deren jeder auf seiner Spitze eine Perle darreicht. Er stand im offenen Fenster, die Bienen begrüßten ihn.
- Jetzt erst weiß ich, daß dieser Baum der Liebe geweiht ist; damals wußt ich's nicht; und jetzt erstehe ich ihn. Sag: kann die Liebe süßer gepflegt werden als dieser Baum? und kann eine zärtliche Pflege süßer belohnt werden als durch eine volle Blüte?
- Ach, die liebe Nonne mit halb verblühten Rosen auf den Wangen, in Weiß verhüllt, und der schwarze Florschleier, der ihren raschen zierlichen Gang umschwebte; wie aus dem weiten Ärmel des schwarzen wollenen Gewands die schöne Hand hervorreichte um die Blumen zu begießen!
Einmal steckte sie ein Kleines schwarzes Böhnchen in die Erde, sie schenkte mir's und sagte, ich solle es pflegen; ich werde ein schönes Wunder daran erleben. Bad keimte es und zeigte Blätter wie der Klee; es zog sich an einem Stöckchen in die Höh wie die Wicke mit kleinen geringelten Haken; dann bracht es sparsame gelbe Blüten hervor ; aus denen wuchs so groß wie eine Haselnuß ein grünes Eichen, das sich in Reifen bräunte. Die Nonne brach es ab und zog es am Stiel auseinander, in eine Kette von zierlich geordneten Stacheln, zwischen denen der Samen von kleinen Bohnen gereift war. Sie flocht daraus eine Krone, setzte sie ihrem elfenbeinemen Christus am Kruzifix zu Füßen und sagte mir, man nennt diese Pflanze Corona Christi.
Wir glauben an Gott und an Christus, daß er Gott war, der sich ans Kreuz schlagen ließ; wir singen ihm Litaneien und schwenken ihm den Weihrauch; wir versprechen, heilig zu werden, und beten und empfinden's nicht. Wenn wir aber sehen, wie die Natur spielt und in diesem Spiel eine Sprache der Weisheit kindlich ausdrückt; wenn sie auf Blumenblätter Seufzer malt, ein Oh! und Ach !, wenn die kleinen Käfer das Kreuz auf ihren Flügeldecken gemalt haben und diese kleine Pflanze eben, so unscheinbar, eine mit Sorgfalt gehegte, künstliche Dnrnenkrone trägt ; wenn wi; Raupen und Schmetterlinge mit dem Geheimnis der Dreifaltigkeit bezeichnet sehen; dann schaudert uns, und wir fühlen, die Gottheit selber nimmt ewigen Anteil an diesen Geheimnissen; dann glaub ich immer, daß Religion alles erzeugt hat, ja daß sie selber der sinnliche Trieb zum Leben in jedem Gewächs und jedem Tier ist. Die Schönheit erkennen in allem Geschaffenen und sich ihrer freuen, das ist Weisheit und fromm; wir beide waren fromm, ich und die Nonne; es werden wohl zehn Jahre sein, daß ich im Kloster war.
Voriges Jahr hab ich's im Vorüberreisen wieder besucht. Meine Nonne war Priorin geworden, sie führte mich in ihren Garten, - sie mußte an einer Krücke gehen, sie war lahm geworden, - ihr Myrtenbaum stand in voller Blüte. Sie fragte mich, ob ich ihn noch kenne; er war sehr gewachsen; umher standen Feigenbäume mit reifen Früchten und großen Nelken, sie brach ab, was blühte und reif war, und schenkte mir alles, nur der Myrte schonte sie; das wußte ich auch schon im voraus. Den Strauß befestigte ich im Reisewagen; ich war wieder einmal so glücklich, ich betete, wie ich im Kloster gebetet hatte; ja selig sein macht beten!"
- In den Brief vom 30. Aug. 1808 schreibt sie an Goethe:
„Du erfreust Dich an der Geschichte des Myrtenbaums meiner Fritzlarer Nonne; er ist wohl die Geschiche eines jeden feurig liebenden Herzens. Glück ist nicht immer das, was die Liebe nährt, und ich hab mich schon oft gewundert, daß man ihm jedes Opfer bringt und nicht der Liebe selbst, wodurch allein sie blühen könnte wie jener Myrtenbaum. Es ist besser, daß man Verzicht auf alles tue, aber die Myrte , die einmal eingepflanzt ist, die soll man nicht entwurzeln - man soll sie pflegen bis ans Ende.“
- Bettine lebte nach der Fritzlarer Klosterzeit von 1801 an meistens bei ihrer Großmutter, die Schriftstellerin, Sof ie von Laroche in Offenbach oder bei ihren Geschwistern in Frankfurt, später bis zu ihrer Verheiratung in der Familie ihres Schwagers von Savigny in Marburg, Landshut und Berlin. Sie kam dadurch mit geistig bedeutenden Männern in Verbindung, wie Achim von Arnim, ihrem späteren Gatten, und den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm.
- Durch diese lernte sie als junges Mädchen im Sommer 1807 in Kassel im Hause ihres Schwagers Jordis den Maler und Radierer Ludwig Emil Grimm, kennen. Über die Brüder Grimm wollen wir die Betrachtungen in der Zeit der Fritzlarer Romantik fortsetzen. Hans Josef Heer
Wochenspiegel Nr. 36/10 vom 3. September 1976, S. 1-2
Fritzlar und die Brüder Grimm in der Zeit der Romantik III
Die berühmten hessischen Brüder Grimm, besonders der Romantiker-Philogoge und Mitgestalter der Deutschen Sagen- und Märchenwelt Wilhelm Grimm und dessen jüngerer Bruder, der Maler und Radierer Ludwig Emil Grimm, waren mehrmals in Fritzlar.
Zu diesem Freundeskreis gehörte auch die Tochter, Marianne Karoline Friederike Christiane von Schwertzell, die seit 1821 mit dem Rittmeister Wilhelm Freiherr von Verschuer in Fritzlar verheiratet war. Dieser stand zu der Zeit, als die Briefe geschrieben wurden, bei dem Fritzlarer Kurhessischen Leibhusarenregiment. Von ihnen stammen 14 an Wilhelm Grimm gerichtete Briefe, und zwar einer aus Willingshausen, einer aus Kassel, elf aus Fritzlar, zwei aus Solz bei Bebra, dem Stammsitz der Familie von Verschuer, und umspannen den Zeitraum von 1820 bis 1829.
Der bekannte Grimmforscher Dr. Wilhelm Schoof schreibt in seiner Abhandlung in der ZHG. Band 57, 1929, „Beziehungen Wilhelm Grimms zur Familie von Schwertzell“ unter anderem folgendes: „Im Sommer 1826 besuchte Wilhelm Grimm die Familie von Verschuer in Fritzlar. Karoline schreibt darüber am 30. Juli 1826 an Wilhelm Grimm: „Aber noch eine herzliche Freude haben Sie mir dadurch gemacht, daß Sie mir sagten, es habe Ihnen gut bei uns in Fritzlar gefallen, und Sie dächten gern daran zurück. Für uns war es eine wahre Erholung und ich wünsche nur, wir könnten öfters die Freude haben.“ Auch im nächsten Jahr, im Spätsommer 1827, war Wilhelm Grimm in Fritzlar bei der Familie von Verschuer zu Besuch. Am 1. August 1826 schreibt Herr von Verschuer an Wilhelm Grimm: „Es ist nun fast ein Jahr, daß wir uns nicht gesehen haben; wir denken noch immer mit Freuden an den Tag zurück, den Sie vorigen Sommer bei uns zubrachten, und haben dabei den lebhaften Wunsch, Sie auch in diesem Sommer wieder hier bei uns zu sehen!“ Und ebenso schreibt Karoline von Verschuer am 30.7.1828 an Wilhelm Grimm: Wie angenehm wäre es für uns, wenn Sie lieber Grimm uns einmal wieder besuchten, wir möchten Sie so gern einmal wiedersehen, kommen Sie dieses Jahr denn nicht nach Möllrich? Richten Sie es doch wieder so hübsch ein, daß Sie von dort dann die größte Zeit bei uns sind, und bedenken Sie, was Sie uns für eine Freude damit machen würden.“ Wir sehen aus den Briefen, daß damals Besuche von Kassel nach Fritzlar nicht so einfach wie heute waren. Die Familie des Rittmeisters von Verschuer wohnte in ihrer Fritzlarer Zeit auf dem Rittergut des Oberst Karl von Baumbach in Obermöllrich, der uns Fritzlarer als Hof der Familie Pfennig bekannt ist und 1967 abgerissen wurde.
Außer Wilhelm Grimm läßt sich sein jüngerer Bruder, der Maler und Radierer Ludwig Emil Grimm 1825 und 1826 in Fritzlar nachweisen. Mir sind drei Bilder von ihm bis jetzt bekannt, „Fritzlar vom Mühlengraben“, ein farbiges größeres Aquarell, sowie aus seinem Skizzenbuch eine Landschaftszeichnung mit Fritzlar und Büraberg im Hintergrund, welche darauf schließen läßt, daß er wahrscheinlich ebenfalls auf dem Rittergut des Oberst von Baumbach wohnte, da die Zeichnung den Richtungsblick von dort aufweist und vom Maler folgende Beschriftung trägt: „Landschaft vor Fritzlar von ober Möllerich gez. Sonntags morgens den 21. July 25“, und die im Wochenspiegel veröffentlichte Skizze „Der Weg zur Ursulinen-Schule“.
1826 war Ludwig Emil Grimm wieder in Fritzlar, wo von ihm eine entzückende Radierung unter dem Namen „Die alte Lore von Ungedanken“ erhalten ist. Die alte Wahrsagerin muß wohl damals die Horoskopstelle unserer Zeit in Ungedanken vertreten haben. Besonders reizvoll für uns ist, daß uns durch dieses Bild die damalige schöne Mädchentracht unserer Gegend überliefert wird und man kann gleichzeitig feststellen, daß es vor 150 Jahren in Ungedanken auch schon schöne Mädchen gab, die neugierig auf ihre Zukunft waren.
In seinen Lebenserinnerungen erzählt uns Ludwig Emil Grimm viel von seiner Familie und von seinen Freunden Achim von Arnim, Clemens Brentano, Bettina von Arnim und Friedrich Karl von Savigny. Auch Goethe hat ihm mehrmals seine Anteilnahme bezeugt und förderte ihn. Der bescheidene und stille Künstler war mehr Zeichner und Radierer als Maler, und so gehören seine Feder- und Bleistiftzeichnungen und Aquarelle zu den reizvollsten Zeugnissen der deutschen Romantik.
Er schuf mehr als hundert radierte Blätter mit Landschaften, Szenen aus dem Volksleben und besonders Porträts. Unter letzteren sind die Köpfe führender Romantiker, wie Clemens Brantano, Betinna von Arnim, Savigny, Görres, seine Brüder Jacob und Wilhelm. Seine Ausbildung fand Grimm an der Kasseler Kunstakademie und in München. 1816 war er in Italien, von 1832 bis zu seinem Tod war er der Akademieprofessor der Kasseler Kunstakademie.
Auf Grund all dieser geschichtlichen Begebenheiten wäre es wohl angebracht, bei der Suche nach geeigneten neuen Straßennamen in Fritzlar auch an eine „Bettina-Straße“ oder „Brüder-Grimm-Straße“ zu denken, welche die Erinnerung an diese berühmten Deutschen in unserer Stadt wachhalten werden.
Hans Josef Heer
Wochenspiegel Nr. 22/11 vom 3. Juni 1977
-----------------------------------------------------------------------------
KENNEN SIE DIE „DEUTSCHE MÄRCHENSTRASSE“?
-----------------------------------------------------------------------------
Die zweite geschichtliche Legende über Fritzlar aus dem „Hessen-Nassauischen-Sagenbuch" von dem Volkskundler Professor Dr. Paul Zaunert bezieht sich auf die Stadtentwicklung und seinen Stadt-Heiligen Sankt Wigbert.
Fritzlar um 730
Es war schon eine Zeit vergangen, seit die heilige Eiche bei Geismar gefallen war, da fing Bonifatius (wie es heißt im Jahre 732) zu Fritzlar an der Eder eine Kirche nebst Klösterlein an zu bauen in St. Peters Ehre unter der Klosterregel des heiligen Benediktus. Soll auch geweissagt haben, daß diese Kirche durch kein Feuer beschädigt werden würde. So ist es auch in der Folgezeit geschehen, als zur Zeit Karls des Großen die Sachsen in das Land fielen und Fritzlar nahmen. Sie steckten die Stadt in Brand, nur die Kirche widerstand dem Feuer, und von den Christen, die auf den festen Büraberg geflüchtet waren, sahen etliche, wie zwei Jünglinge in weißen Kleidern das Gotteshaus beschirmten.
Zu den Zeiten des Bonifatius war St. Wigbert in England aus einem adligen Geschlechte des Volkes, genannt Angelsachsen, der verließ die Welt und führte ein göttliches und tugendhaftes Leben. Als das Bonifatius erfuhr, da sandte er Botschaft zu ihm und bat ihn, daß er wolle herauskommen nach Deutschland und ihm helfen arbeiten in dem Weingarten Gottes. St. Wigbert kam und predigte und lehrte das Volk den Weg der Seligkeit. Da setzte ihn Bonifatius nach Fritzlar zu einem Regierer der Mönche. Da er dann ein gar strenges und geistliches Leben führte manche Zeit. Danach sandte ihn Bonifatius nach O¬druff hinter dem Doringer Wald (Thüringer), daselbst auch ein geistliches Leben zu pflanzen, und da wohnte er auch geraume Zeit. Zuletzt aber kam er wieder gen Fritzlar. Und zu einer Zeit stand er über dem Altar und las die Messe. Und da er den Kelch bereiten wollte, so war nicht Wein da. So ging er heraus vor die Kirche, wo er Weinstöcke mit Trauben wußte, brach eine Traube ab, ging wieder über den Altar und preßte zwischen seinen Händen den Wein in den Kelch. Zuletzt fand er noch ein ganzes Korn in dem Kelch, und alsbald ging er wieder heraus, pflanzte das Weinkorn in die Erde und brachte danach das Amt der Messe vollends aus.
Da das geschah, da fragte ihn ein Mönch, seiner Brüder einer, was er damit meine, da sprach er: „Ist es an dem, daß Gott meine Sachen behagen, das wird man über neun Jahre erfahren daraus." Und als die neun Jahre um waren, da stand ein schöner Weinstock an der Statt, wo er das Weinkorn gepflanzt. Dadurch verstanden sie, daß Wigbert ein getreuer Arbeiter im Weingarten Gottes war. Und danach, da man schrieb nach Gottes Geburt 740 Jahr, da starb er eines seligen Todes. Und ward vor der Kirche zu Fritzlar begraben, wo dann viel Wunder geschahen an seinem Grabe.
Zu der Beschreibung auf der Vorderseite paßt sehr gut ein 1200 Jahre später verfaßtes romantisches Gedicht, wahrscheinlich von einem heimat-vertriebenen Dichter, aus der Sonntagsbeilage „Deutsches Vaterland" der Kasseler Post vom 4. April 1954:
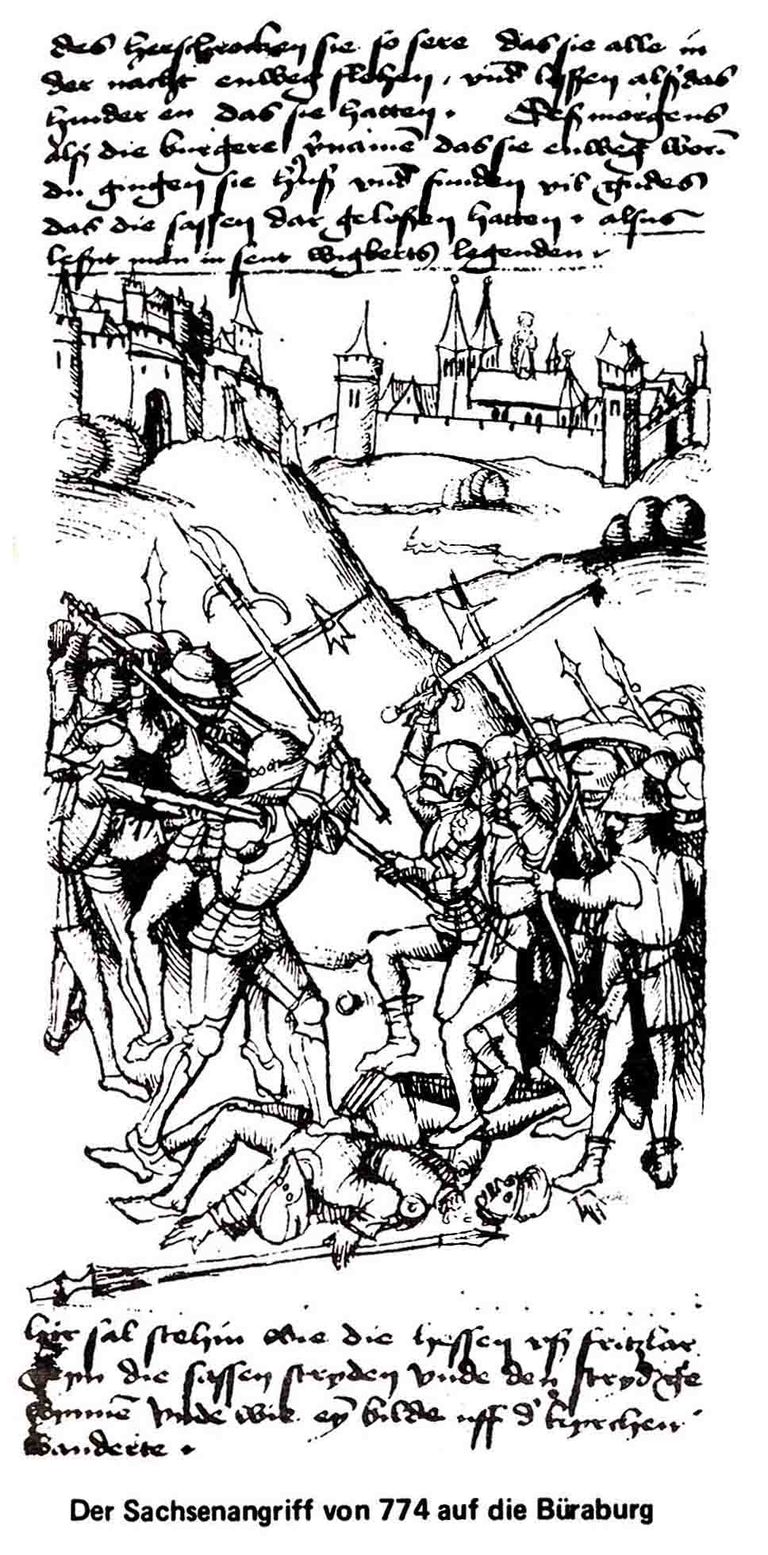
Wochenspiegel Nr. 26/11 vom 1. Juli 1977, S. 1-2
Kennen Sie die »Deutsche Märchenstraße« ?
Die letzte Geschichte aus dem „Hessen-Nassauischen Sagenbuch“ von dem Volkskundler Professor Dr. Paul Zaunert befaßt sich mit den Schrecken des Siebenjährigen-Krieges in Fritzlar (von 1756 bis 1763).
BONIFATIUS RETTET FRITZLAR
Im Siebenjährigen Krieg, als die Franzosen Fritzlar besetzt hielten (denn Fritzlar war damals noch mainzisch, und Mainz hielt mit Kaiserin und Reich und Franzosen gegen Preußen und Hessen in Braunschweig), da kamen einst die verbündeten Truppen vor die Stadt und beschossen sie dermaßen, daß den Bürgern himmelangst wurde und sie laut zu klagen begannen. Da hieß es auf einmal, Bonifatius sei wiedergekommen, um seine Stadt zu retten. Alles Volk strömte dem Haddamarer Tore zu und sah mit eigenen Augen, wie der Heilige auf der Mauer stand,- mit einem weißen Tuche fing er die Kugeln auf, und die prallten alle davon zurück auf die Feinde. Wie nun die feindlichen Soldaten sahen, daß so viele von den Ihrigen fielen, ohne daß von Fritzlar her auch nur eine Muskete abgeschossen wurde, da befiel sie große Furcht, die Befehlshaber mußten den Sturm aufgeben und zogen unverrichteter Sache mit ihren Leuten ab. Alsbald war auch Bonifatius wieder von der Mauer verschwunden. Soweit das Sagenbuch von Zaunert.
Es mag diese Sagendarstellung etwas zu naiv klingen, aber der tatsächliche Verlust an Menschenleben in Fritzlar muß wohl gering gewesen sein. Ein Augenzeugenbericht des Altarristen Heinrich Schüssler überliefert uns über den 14. und 15. Febr. 1761 im damaligen Schriftdeutsch folgendes:
„Samstag, den 14. Febr. kamen die Alliierten mit ca. 20 000 Mann, wie dafür gehalten wird, mit 50 Canonen von verschiedenen Calibre aus dem Englisch-Hessisch-Hannöverisch- und Bückeburgischen Artilleriebarque bestehend unter Anführung seiner Durchlaucht dem Herren Erbprinzen, ja sogar des Herrn Herzog Ferdinand von Braunschweig Durchlaucht selbsten, nebst dem Englischen Lilord Gramby hier vor der Stadt an und machten mit der Canonanden gegen die Stadt um 7 Uhr morgens von allen Ecken, außer von der Eder her, den heftigsten Anfang, continuierten damit, doch ohne feurige Kugeln, den ganzen Tag mit bißweiligen Inhalten.
Dem französischen Commendanten Graf von Narbonne Pelet in unserer Stadt, wurde nachmittags abermahlen ein honorabeler Accord angeboten, wenn er ausziehen würde, da aber der Herr Commendant dafür hielte, daß einige Cavallerie Regimenter der Alliierten, welche über die Niedermöllericher Brücke der Eder sich jenseits der Eder hinauf bis ins hiesige Unterfeld gezogen und in 8 Divisionen gestellt hatten, französische Securs-Völker wären, wurde der abermals angebotene Accord abgeschlagen, ohngeachtet in der Stadt bereits ein großer Schaden an Kirchen, Klöstern, Thürmen und Häusern durch 3-, 6- und 12-pfundige Canonenkugeln, deren über 3000 zum wenigsten in hiesige Stadt geflogen sind, leyder, geschehen war.
Den 15. Februar morgens 7 Uhr fingen abermals die Alliierten an mit einigen Bomben und unterschiedlichen feurigen Kugeln in die Stadt zu spielen, verursachten auch hie und da einigen Brand, welche jedoch gleich mit Hülff der Cuarnison gelöscht wurden, da solches der Herr Commendant erfahren, ließ er Chamade schlagen, worauf gegen 8 Uhr mit einem Stillstand die Capitulation durch Übersteigung deren Adjutanten mit Leitkern über die erbärmlich zugerichtete und stark zerschossenen Stadtmauern alliiertenseits beym Herren Erbprinzen von Braunschweig zu Fraumünster, französischerseits in dahiesigen Deutschen Ordens Hofe vorgenommen worden.
Es wollte aber, ohngeachtet mehrmaligen Hin- und Herschicken beiderseitiger Adjutanten und ohnangesehen von Stifft- und stadtseitigen der Herr Commendant kräftigst ersucht worden, die vorgeschlagene Capitulation zur Verhütung fernerer Verwüstung der Stadt einzugehen, bis 11 Uhr nicht zum Stande gebracht worden, weilen der Herr Commendant darfür gehalten, daß die angebotene Bedingungen nicht genugsam honorabel für seinen König, für den Commendanten und die Carnison seyen, worauf alsbalden die stärksten und entsetzlichsten Canonaden von allen Ecken her mit Einwerfung von Bomben, feurigen Kugeln, Haubitzen, Pechkränzen, Trauben oder Cartätschen, deren feuerspeienden Materien viele Tausend (ohne in der Stadt was anzuzünden) gefallen seyn, nebst gewöhnlichen großen und kleinen Canonkugeln, nicht ohne Jammern deren einer augenblicklichen Todtesgefahr ausgesetzten Einwohnern, aufs allererbärmlichste anfingen und bey 2 Stund ohne Unterlaß darmit continuiret wurde.
Solches der Herr Commendant, und das die Stadt zum Steinhaufen werden könnte, ersehend, die Chamade abermahl schlagen ließe, die Capitulation, wovon die Puncta in der Stadt nicht bekannt worden, wieder ihren Anfang nahm und nach 3 Uhren nachmittags geschlossen wurde, gegen abends aber 7 Uhr der Aus- und Abzug der in 900 bis 1000 Köpfe bestandener französischen Carnison (Wovon während der Belagerung ein einziger todt verblieben u. 5 verwundet worden) mit klingendem Spiel, fliegenden Fahnen, rührender Trommel, geschultertem Gewehr, 2 bedeckten Wagen und einer kleinen mit sich führender und mit hereingebrachter Canone, Amuset genannt, dann allen Kriegs Ehrenzeichen und gänzlicher Bagage unter Convoy englischer Cavallerie zum Münsterthor hinaus zogen.“
Man ersieht aus diesem Bericht, welch ein großer Spektakel solche Kriege zu allen Zeiten für die arme Bevölkerung alter Städte und Dörfer waren, und wenn man dabei noch sein Leben gerettet hatte, glaubte man sicherlich gern an ein Wunder.
Hans Josef Heer
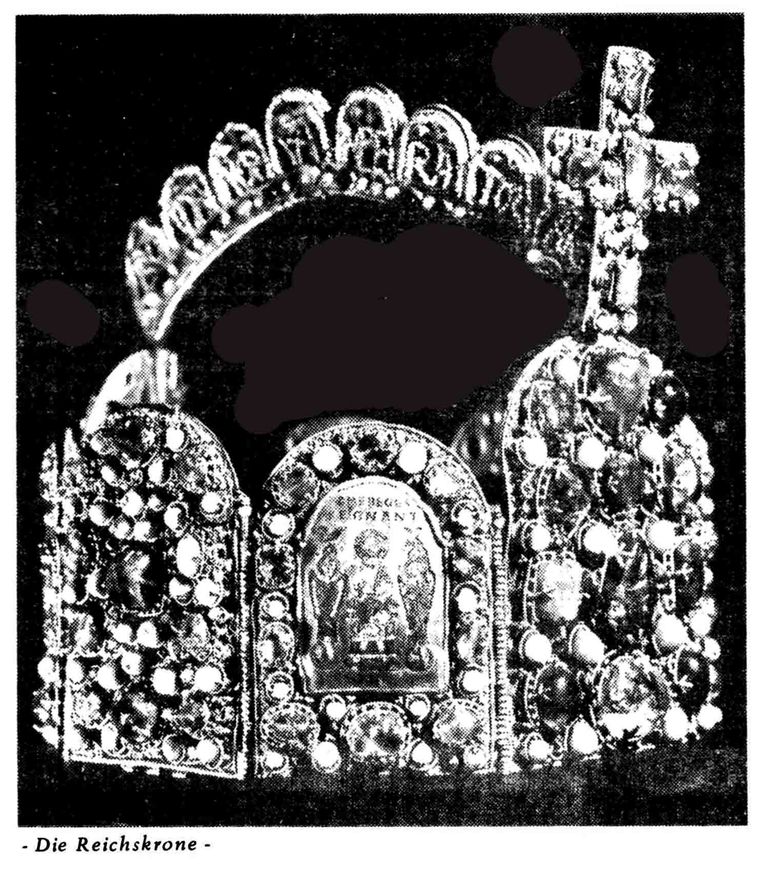
Dem Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde ist es gelungen, die bedeutendste Kaiser- und Königskronensammlung zu einer Ausstellung im Fritzlarer Kaiserdom zu bekommen. Die Ausstellung wird vom 8. Juli bis 1. August 1977 im Domschatz zu Fritzlar sein.
Wer die kunstvollen Kronen der Welt besichtigen wollte, müßte im Tower von London, in der Wiener HoJburg, in der Rüstkammer des Moskauer Kremls und an vielen anderen Platzen gewesen sein. Viele Kronen sind der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich, andere verschollen.
Der schlechte Zustand der Deutschen Reichskrone brachte den Wuppertaler Goldschmied Jürgen Abeler auf die Idee, die Herrschaftszeichen der Welt nachzugestalten. Unter seiner Regie entstanden bisher 72 originalgetreue Nachbildungen, die zusammen mit 18 echten Kronen und Insignien auf einer Wanderausstellung in Europa und Amerika gezeigt wurden; Millionen von Besuchern haben sie schon bewundert.
In der Tat ist das, was Goldschmiede, Ziseleure, Graveure, Emailleure und Steinschneider mit dieser Ausstellung auf die Beine gebracht haben, um dem Menschen von heute einen Einblick in die Pracht der weltlichen und geistlichen Herrschaftszeichen zu bieten, in dieser Art wohl einmalig. Vom Diadem, dem Kronreif aber Mitra, Tiara, Schulen-, Votivkronen bis hin zu den venezianischen Dogenmützen kann man auf dieser Ausstellung bewundern.
Bauwerke, Straßen, Städte und Staaten haben oft eine lange Geschichte. Auch Kronen, jahrhundertelang das Zeichen der Macht, Herrschaft und des Reichtums, wüßten bestimmt eine Menge aus ihrem »Leben« zu erzählen, wenn sie nicht nur ein Metallzierwerk wären. Sie würden aber Kriege, Herrschaftswechsel, schöne Frauen und stattliche Könige berichten, über Feste und Plünderungen, aber friedliches Leben und Revolutionswirren. Weil die kostbaren Symbole vergangener Herrlichkeit nicht selbst erzählen können, haben es ihnen stets geschichtsinteressierte Menschen abgenommen und die »Lebensgeschichte« der Kronen schriftlich aufgezeichnet.
Recht turbulent ging es im Leben der Kronen der Anden zu. Um von der Pest verschont zu bleiben, legten die Bewohner der peruanischen Stadt Popaydn im 16. Jahrhundert das Gelübde ab, eine Krone zu stiften. Die Überlieferung sagt, daß ein Goldklumpen von 100 Pfund Gewicht und Smaragde von 1521 Karat verarbeitet wurden. Im Jahre 1593 war die Krone fertig. Kurz darauf fiel das Prachtstück in die Hände einer Piratenbande, konnte den Seeräubern jedoch schnell wieder abgejagt werden. In Einzelteile zerlegt hat man sie dann »begraben«. Rund 300 Jahre später war die » Wiederauferstehung«. Zugunsten von Kranken- und Waisenhäusern verkaufte man die Krone im Jahre 1909 mit Zustimmung des Vatikans an eine amerikanische Stiftung, in deren Besitz sich das Kleinod noch heute befindet.
Noch bewegter war das Leben der Reichskrone, die viele Generationen verschiedener Herrscherfamilien auf dem Kaiserstuhl des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation »überlebte«. Zehn dieser deutschen Kaiser von Otto I. 936 bis Konrad III. 1152 haben sogar in Fritzlar residiert. Die Reichskrone entstand unter Otto IL zur Kaiserkrönung desselben. Bis zum Jahre 1792 hat sie wohl jeder deutsche Kaiser mindestens einmal getragen. In den ersten »Lebensjahrhunderten« wanderte sie von einer Herrscherresidenz zur anderen, Kaiser Sigismund befahl die Krone 1424 »unwiderruflich und ewiglich« in die Obhut der Nürnberger Bürger. Vor Napoleons Truppen wurde sie 1796 nach Wien gerettet. Die Österreicher wollten sie später nicht wieder herausgeben. Erst das Hitlerregime holte den Kronenschatz zurück nach Nürnberg und stellte ihn in der Katharinenkirche glanzvoll zur Schau. Bei Kriegsende mauerte man den Schatz in der Nürnberger Burg ein. Das nützte jedoch nichts. Die Siegermachte fanden die Kleinodien trotzdem und gaben sie nach Wien zurück. Dort fristet die Krone seither in der Schatzkammer der Wiener Hofburg ihr Dasein.
Chronologisch zeigt die Ausstellung Kopfschmuck und Zeichen der Würde aus vielen Jahrhunderten. In der Art der Zeitraffung ziehen durch die Rekonstruktionen Geschichten der Völker, Schicksale derer Herrscher und Meisterwerke alter Goldschmiede und Juweliers vorüber. Studien und Stilkunde, der Techniken und der geistigen Hintergründe bietet diese Ausstellung reiches Lehrmaterial, welches sich mit dem kostbaren Domschatz, insbesondere in Verbindung mit dem Fritzlarer Kaiser-Heinrich-Kreuz, vergleichen läßt.
HANS JOSEF HEER
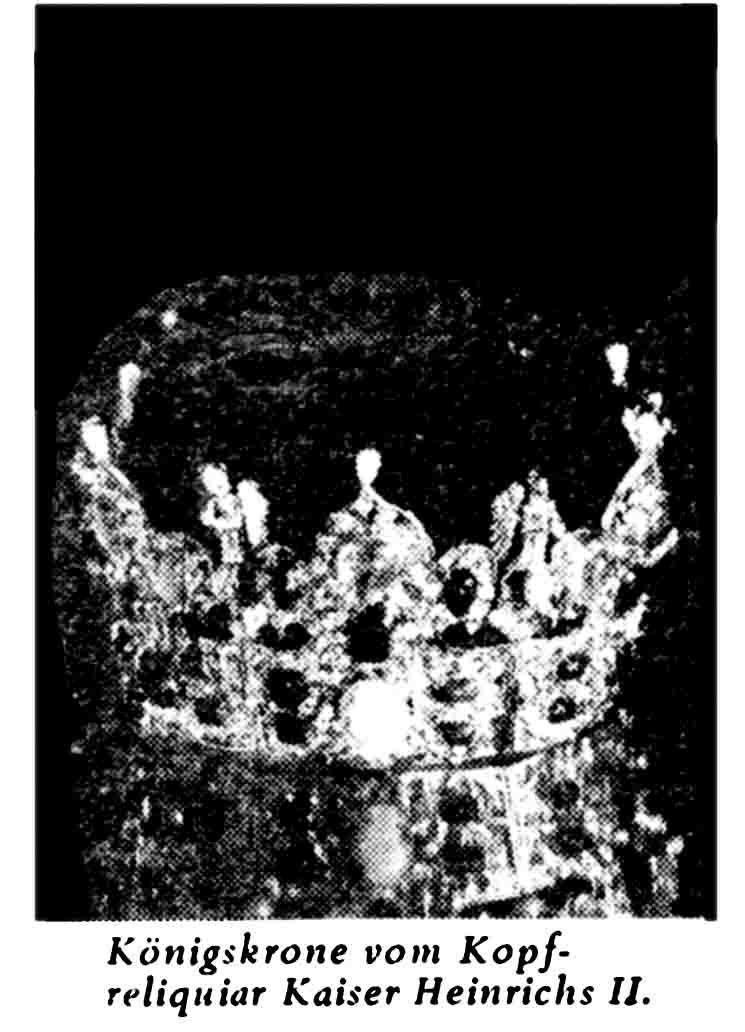
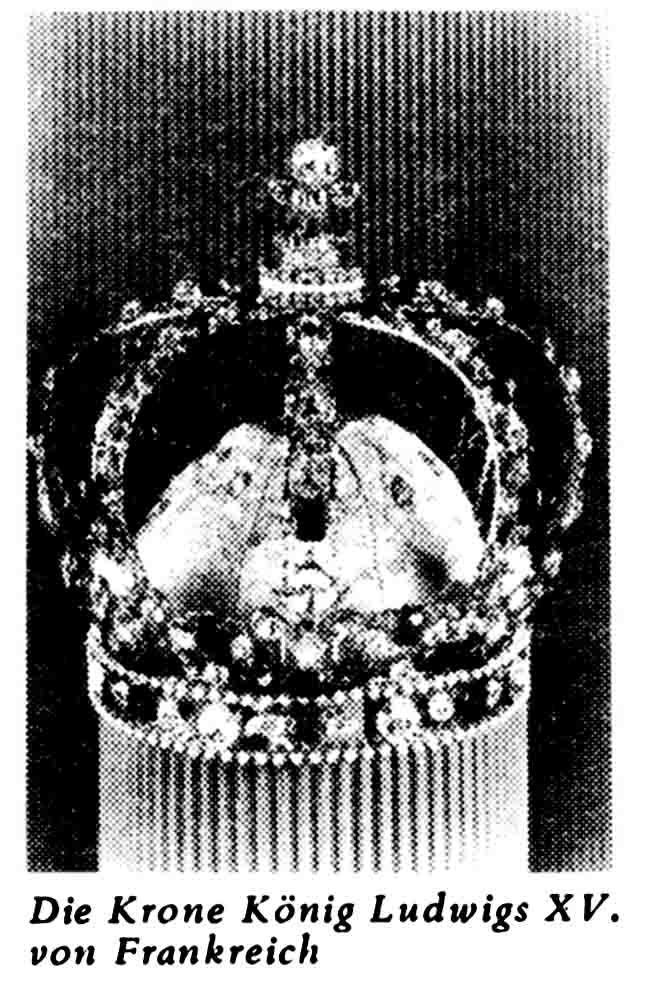
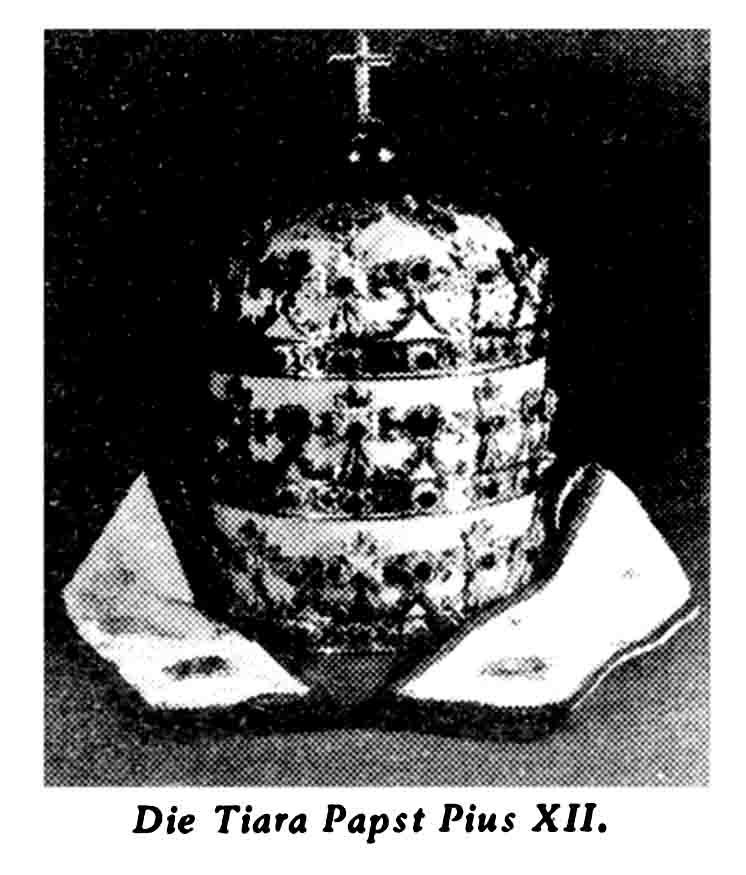

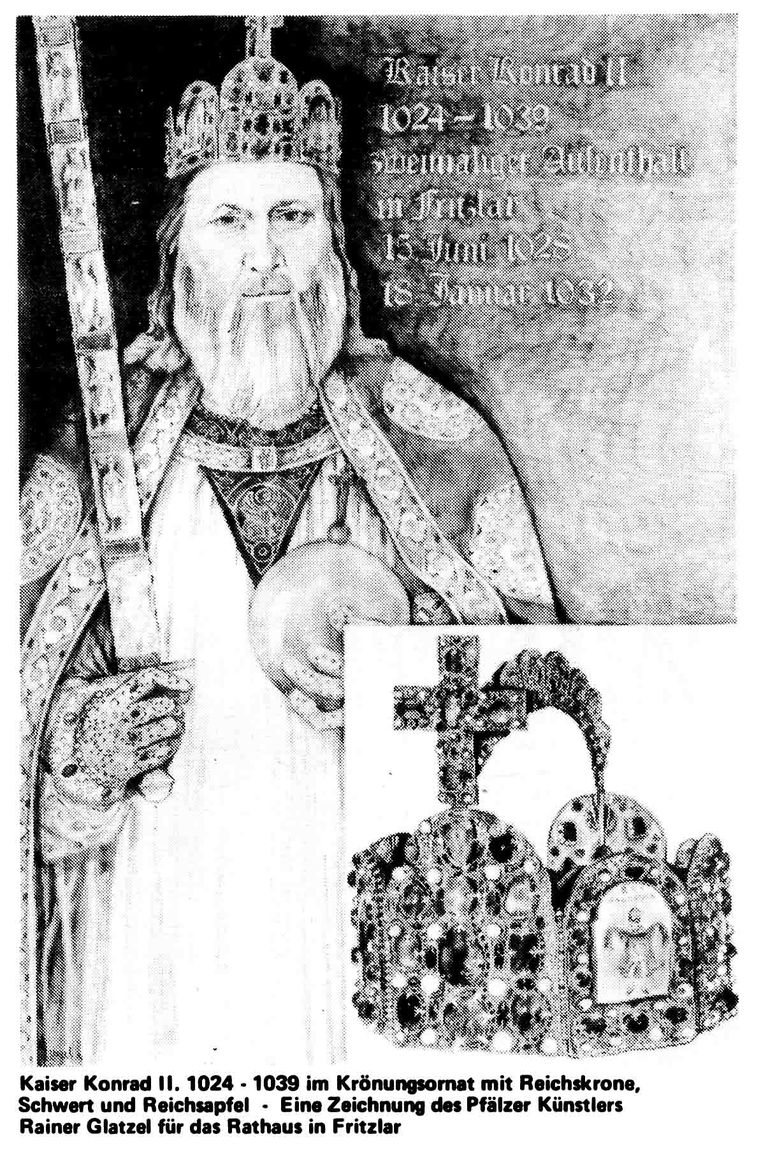
GEDANKEN ZUR KRONENAUSSTELLUNG
im Kaiserdom zu Fritzlar
Kronen sind Herrschaftszeichen der Welt. Die symbolische Darstellung der Macht erfolgte in der Geschichte der Menschheit immer durch ein Symbol, das auf dem Kopf getragen wurde. Ob es der weiße Generalsbusch am Helm des preußischen Reiterführers Seidlitz in der Schlacht bei Roßbach war, oder die Kronen auf den Häuptern der Kaiser und Könige bei ihren Staatsempfängen.
Ich möchte hier nicht näher in die verschiedenen Weltbereiche des Kronenkultes eingehen, sondern nur kurz auf die Gepflogenheiten der Reichsinsignien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation hinweisen. Weil wir in Fritzlar gerade für diese Zeit durch elf deutsche Kaiser und Könige auf das engste mit der Geschichte des Reiches verbunden waren. Denn das historisch bedeutendste Ereignis in der 1250jährigen Geschichte Fritzlars ist zweifellos die Erhebung Heinrichs I. zum deutschen König im Mai 919 durch die dort versammelten Franken und Sachsen. „Von da an“ bemerkte Otto von Freising, der größte Geschichtsdenker des deutschen Mittelalters, schon vor mehr als 800 Jahren in seiner Chronik „von da an rechnen manche dem Reich der Franken das der Deutschen“.
Hier in Fritzlar am Domplatz haben wir uns die weltgeschichtliche Stätte zu denken, an der die Wahl des Sachsenherzogs Heinrich zum deutschen König erfolgte. Aber auch hier in Fritzlar hatte der sterbende König der Franken, Konrad I., hochsinnig nicht an sein Haus, sondern an das Reich gedacht und durch seinen Bruder die Insignien des Reiches an den Herzog Heinrich von Sachsen, „den würdigsten und mächtigsten Fürsten“ überreichen lassen.
Professor Percy Ernst Schramm, einer der bedeutendsten Fachwissenschaftler auf diesem Gebiete, schreibt in seinem Buch „Denkmale der deutschen Könige und Kaiser“, folgendes:
Unter den weltlichen Besitztümern der Könige standen natürlich die Insignien oben an, durch die sichtbar gemacht wurde, daß sie die Herrscher waren. Aus den Angaben des lateinischen „Ruodlieb-Romans“ um 1040 ergab sich bereits, daß die Herrschaftszeichen in den Pfalzkapellen verwahrt und von den Kapellanen betreut wurden. Denn der heilige Schimmer, der auf den liturgischen Geräten der Kapellen und ihren Reliquien ruhte und sich auch den in ihrer Mitte verwahrten Herrschaftszeichen mitteilte, hat sich in der Folgezeit nicht vermindert, ja wohl noch verstärkt.
„Heilig“ konnte eine Krone mit Fug und Recht genannt werden, wenn in sie eine Reliquie eingefügt war. Das ist bereits im 9. Jahrhundert der Fall, ja, der Legende nach hatte bereits Konstantin der Große die Nägel vom Kreuze Christi in seinen Helm und sein Zaumzeug einschmieden lassen. Auf dem in das Blatt der Heiligen Lanze eingefügten Nagel Christi beruhte das Ansehen dieser seit dem 10. Jahrhundert zum Reichshort gehörenden Waffe, die Reliquie und Herrschaftszeichen.zugleich war.
Gerade in dieser Hinsicht haben wir in Fritzlar eine der kostbarsten Reliquien in dem hervorragend gearbeiteten Kaiser - Heinrich - Kreuz aus dem Jahre 1020, dessen 346 Edelsteine in Goldfilet gefaßt, die alle die Aufgabe haben, das geheiligte Mittelstück, einen großen ovalen, durchsichtigen Bergkristall mit einem Kreuzpartikel vom „Kreuz Christi" zu umrahmen.
Aus der Geschichte wissen wir, daß oft Kronen von einem Herrscher an einen anderen verschenkt worden sind, um ihn zu ehren und um - offen oder versteckt - zum Ausdruck zu bringen, daß der Empfangende der Abhängige sei. Wer die Herrschaftszeichen des Vorgängers übernommen hat, ist der rechmäßige Herrscher. Sie bilden für ihn, was das Siegel für die Urkunde bedeutet: die Rechtsbekräftigung.
Was Kronen für das Heimatgefühl der Menschen noch heute bedeuten können, habe ich 1950 in den Vatikanischen Museen erlebt, da standen tausende von heimatvertriebenen Ungarn vor der Stephanskrone, die Reichskrone des alten Ungarreiches, mit Tränen in den Augen beteten sie um die Erhaltung ihrer angestammten Heimat zum christlichen Glauben.
All diese Kostbarkeiten von Kronen aus den verschiedenen Zeiten und Nationen werden uns hier im Dom im Original und kunstvollen Nachbildungen zur Anschauung geboten, anders ist es auch gar nicht möglich, selbst nicht auf der großen Staufer-Ausstellung in Stuttgart, wo Kopien und Originale eine Einheit bildeten, und auch da haben gerade unsere kostbaren romanischen Stücke des Fritzlarer Domschatzes mit dazu beigetragen, uns Menschen des 20. Jahrhunderts einen Einblick in das Kunstschaffen der letzten tausend Jahre zu bieten.
HANS JOSEF HEER
Wochenspiegel Nr. 46/11 vom 18. November 1977, S. 1-2
EIN BEITRAG ZUR MUSIKGESCHICHTE FRITZLARS
von Hans Josef Heer
Fritzlar, als eine der ältesten Kulturstätten östlich des Rheins und nördlich des Mains, tritt bereits 724 durch die Missionstätigkeit des Apostels der Deutschen, Bonifatius, in das hellere Licht der Geschichte. Nach der Fällung der Donareiche bei Geismar gründete Bonifatius 732 in Fritzlar ein Benetiktinerkloster, welchem gleichzeitig eine Klosterschule angeschlossen wurde. Die Leitung dieser Klosterschule lag in den bewährten Händen des ersten Fritzlarer Abtes Wigbert, welcher diese zu hoher Blüte brachte, so daß aus derselben Männer wie Sturmi, der Gründer von Hersfeld und Fulda, sowie der Franke Gregor, nachmals Abt von St. Martin in Utrecht, hervorgingen.
Schon in dieser ersten Schule des Hessenlandes fand die religiöse und geistige Musik, welche im frühen Mittelalter fast nur kirchlichen Charakter hatte, ihre erste Pflegestätte. Denn es wird uns durch Urkunden bewiesen, daß das Kloster Fritzlar an dem reichen musikalischen Leben des Benediktinerordens in jenen Jahrhunderten teil - nahm.
„Die Bedeutung Fritzlars in der Reichsgeschichte nahm von Jahr zu Jahr zu, und erhielt in der Königswahl Heinrichs 1. (919) ihren ersten Gipfelpunkt. Denn diese erste Wahlversammlung leitete eine Reihe weiterer glanzvoller Reichs- und Kirchenversammlungen ein, die sich bis in die Zeit Heinrichs V. erstreckten. Fritzlar wurde nun vom Anfang des 10. bis Ende des 12. Jahrhunderts zum bevorzugtesten Aufenthaltsort der deutschen Könige in Hessen. Besonders Otto der Große, Heinrich 11 1. und Heinrich IV. sind wiederholt hier anzutreffen. Aber auch fast alle anderen deutschen Herrscher von Heinrich 1. bis Konrad 111. haben öfters in Fritzlar geweilt.“ Insgesamt sind 21 Königsbesuche und 8 glanzvolle Kirchenversammlungen in Fritzlar nachzuweisen.
Daß diese Feierlichkeiten mit den damalig üblichen musikalischen Darbietungen verbunden waren, ist ohne weiteres anzunehmen. Treten uns doch gerade aus diesem höfischen Zeitalter zwei deutsche Minnesänger entgegen, welche mit Fritzlar aufs engste verbunden waren. Ihre Namen sind: „Herbort von Fritzlar“ und „Heinrich von Meißen“.

Der erste erhielt, unter Aufforderung des in Hessen regierenden Landgrafen, Hermann von Thüringen, der ein Freund der klassischen Kunst und ein Förderer der Dichtung seiner Zeit war, den ehrenvollen Auftrag ein „Liet von Troye“ (Troja) zu schreiben. „Herbort von Fritzlar“ unterzog sich dieser Aufgabe. Er dichtete in Anlehnung an die antike Dichtung den „Trojanischen Krieg“ im höfischen Stil. Vorbild zu dieser Arbeit war ihm Heinrich von Veldekes „Eneit“. Das Liebespaar Troilus und Cressida spielt auch in seiner Dichtung die Hauptrolle. Der „Trojanische Krieg“ Herborts von Fritzlar umfaßt 18 458 Verse. Der Minnesänger selbst fühlt sich als Meister und Beherrscher des gewaltigen Stoffes, den er sich zum Vorwurf genommen hat. Seine Dichtung beginnt:
„Swer siner kunst meister ist /der hat gewalt an siner list/ der kan sie bekeren/ minren und meren/ witen und engen/ kyrtzen und lengen/ des ist der tichtere /wiß und gewere.“
Und die Schlußverse lauten:
„Ir hat diz getichte wol gehort Es tichte von fritslar herbort ein gelarter schulere. Es en ist nicht achtbere, daz er icht dichten kan, doch so nimet er sie's an mit andern tichtern, der schar wil er meren. Er gert anders lobes nit Alsus endet sich diz liet.“
Diese Dichtung des Fritzlarer Minnesänger gehört mit zu den besten Dichtungen des früheren Mittelalters.
Der zweite war Heinrich von Meißen auch „Frauenlob“ genannt, er ist mit festem Bande an die Stadt Fritzlar verknüpft. Bernhard Falckenheiner weist 1841 in seiner Geschichte Fritzlars darauf hin, daß Frauenlob sehr wahrscheinlich der Fritzlarer Schule oder der Stadt und dem Stift angehört habe. Wenngleich Frauenlob auch Mainzer Domherr war, so schließt das angesichts der engen Beziehungen zwischen Mainz und Fritzlar nicht aus, daß er dort ein Kanonikat als Pfründe nebenher genoß. Das eine ist sicher, daß zwei seiner engsten Verwandten in Fritzlar Ratsherren waren „Er selbst war der alten Zunft der Michelsbrüder daselbst so bekannt und wert geworden, daß auf der inneren Seite des Umschlags um die im Jahre 1387 niedergeschriebenen Statuten der Michelsbrüder zu Fritzlar sich der Name des Heinrich Frauenlob neben einem Madonnenbild und einigen Versen eingetragen finden, welche also lauten:
„ich komme dorch frawen ere her wer ir schilt und auch ir sper dorch var ich in deine Lande entwer.“
Fortsetzung folgt
Wochenspiegel Nr. 49/11 vom 8. Dezember 1977, S. 1-2
EIN BEITRAG ZUR MUSIKGESCHICHTE FRITZLARS
von Hans Josef Heer
1. Fortsetzung:
Das alte bonifatianische Benediktinerkloster verwandelte sich wahrscheinlich um das Jahr 1000 in ein Chorherrnstift. Der höchste Geistliche dieses St. Petrus-Stiftes war der Propst. Die hohe Stellung, die der Propst von Fritzlar in ganz Hessen einnahm, machte die Propstei selbst für Fürsten und Grafen begehrenswert, unter denen sich auch viele aus dem höchsten deutschen Adel befanden. Dieses Stift wurde nun in der Folgezeit der Hauptträger aller kulturellen Einrichtungen in Fritzlar, und damit auch in den musikalischen Angelegenheiten.
„An der Spitze des Stiftes selbst standen drei Prälaten, die, wie der Propst, Priester sein mußten: Dechant, Scholaster und Kantor. Dem letzteren unterstanden noch der Koncentor und der Succentor, die beide die liturgischen Chorgesänge zu leiten hatten.“
Ein Statut, von dem Kapitel im Jahre 1341 festgesetzt, besagt: „…daß jährlich an einem bestimmten Tage, derjenige unter den Stiftsherren, welchen dann die Reihe trifft, im Amt zu sein (Kantor), jedem Chorknaben, deren 12 an der Zahl sind, 7 Ellen Tuchs von grauer, oder doch einer, von der Kleidung des succentoris nicht abstechenden Farbe ankaufen soll. Die Eile soll 3 Schilf. Fritzlarer Währung, d. h. drei Tour'sche Groschen, nicht mehr und nicht weniger kosten. Zwei geprüfte und geschworne Tuchschneider haben als Kunstverständige dies Tuch vor der Vertheilung, nämlich noch vor St. Catharina Tag zu besehen und zu schätzen, worauf es dann, wenn sie es für preiswürdig gefunden haben, zeitig genug vertheilt werden soll, da mit die Choristen auf St. Barbarä damit bekleidet erscheinen können.
Auch soll jährlich von dem Nachsänger (succentor) und dem Stifts-Schulmeister eine Prüfung (Examen) der Schüler und der Choristen gehalten werden, damit man von ihrem Lebenswandel, Kenntnissen, Gesangfertigkeit und Stimme die nöthige Kunde habe, und die Fähigsten und Würdigsten sich darüber öffentlich erklären, dem Chor in der ihnen zukommenden Kleidung ein Jahr lang dienen zu wollen; - widrigenfalls aber, und wenn einer der Choristen sterben oder sonst abgehen sollte, dem Nachsänger das Kleid zu überlassen oder dessen Werth zurückzuzahlen. Der succentor und magister scolarium dürfen auch an die Stelle jedes abgehenden Choristen einen sich dazu eignenden (nur nicht eine Geweiheten oder sonst im Dienste des Stifts schon Stehenden, - wodurch dieser nämlich mit seinen früher übernommenen Pflichten in einen Widerstreit gerathen würde) erwählen, so wie sie auch das Recht haben, die Vergehungen der Choristen und Schüler zu strafen, und wenn die Strafe nicht hilft, dieselben zu entsetzen.“
Wir ersehen also aus diesem Statut, daß die Sängerschaft des Stiftes nicht Geweihte oder Stiftsangestellte waren, sondern Sänger aus der Fritzlarer Bevölkerung.
Zur Deckung des Unkostenaufwandes verfügte das frühere St. Petri-Stift über eine eigene „Musik-Casse“. Sie verdankt ihre Entstehung einer Reihe von Stiftungen für die Aufführung musikalischer Totenämter und dem Einkommen des Kantors, welche bestanden in den Zehnten von Lekringhausen, Krs. Wolfhagen, von Borken und Besse, wodurch dieser in der Lage war, solche Ausgaben für die musikalischen Bedürfnisse zu tätigen, denn zusätzlich gehörte zum Bestand des Stiftes noch ein grosser Stab geschulter Instrumentalmusiker.
Welche Pflege und Schulung in damaliger Zeit die Sänger und Musiker genossen haben, beweist uns andererseits das einzigartige noch heute im Dome vorhandene Musikzimmer.
Professor Chr. Rauch schreibt wie folgt darüber:
„Das sogenannte Musikantenzimmer über dem Kreuzgang ist von hoher kunstgeschichtlicher Bedeutung durch seine spätgotisehe Wand- und Deckenbemalung in Leimfarben, die, wie der Entdecker Carl Schäfer sagt, `eines der lehrreichsten unter den vorhandenen Beispielen gotischer Polychromierung in Deutschland bietet.´ Es muß nach Ausweis des Wappens des Dekans Johannes Imhof, der 1466 Dekan wurde und 1478 starb, zwischen diesen Jahren erstanden sein.
Geteilt sind die Wände durch ein schabloniertes Maßwerkband, weiß auf schwarz und braun mit sieben Wappen in rot und weiß. (Sternen, von der Malsburg, Brencken, Borgholze, Imhof (Dekan), Heller, Koch. Dazu das Mainzer Rad zweimal zur Seite des Stiftswappens mit den gekreuzten Schlüsseln). Die Unterwand ist mit weißen Ranken und Teppichfalten auf braunrotem Grunde, die Oberwand und die Decke mit freihändig gezeichneten roten Ranken auf weißen Putzgrund bemalt.
Vor dem frei gebliebenen Streifen der Unterwand sind Sitzplätze oder Truhen zu denken. An der Nordwand die Darstellung der Kreuzigung mit Maria und Johannes. Der Raum umfaßt eine Größe von 7 m Länge, 2,35 m Breite und 2,45 m Höhe. Er war jedenfalls - auch ein Teil der Inschriften weist darauf hin - für die musikalischen Übungen der Chorschüler bestimmt.“
Fortsetzung folgt

Photographie Bernhard Hinz: Dom St. Peter zu Fritzlar, Kassel 2002, S. 23, Abb. 14
Wochenspiegel Nr. 50/11 vom 15. Dezember 1977, S. 1-2
EIN BEITRAG ZUR MUSIKGESCHICHTE FRITZLARS
von Hans Josef Heer
2. Fortsetzung:
Zeugnisse von dem hohen Stand der Fritzlarer Buch- und Notenmalereien, welche den Arbeiten der bekannten Fritzlarer Goldschmiedeschule in keiner Weise nachstehen, sind uns noch heute als Graduale aus den verschiedenen Jahrhunderten im Fritzlarer Dom-Museum, Kasseler Landes-Museum und der Gräflich Schönbornschen Handschriftensammlung in Pommersfelden bei Bamberg erhalten.
Über die Art der damaligen Lieder bekommen wir Aufklärung durch den Stiftsschreiber Conrad Linge von Gudensberg; er überlieferte uns: „Die Hymnen des Lectionarium Fritzlariense vom Jahre 1420“. Es handelt sich dabei nur um die Gesänge der zweiten Hälfte des Kirchenjahres von Ostern bis Advent), und umfaßt insgesamt 70 Hymnen.
Früh fand auch in Fritzlar schon die Orgelmusik ihren Eingang, unter der besonders die Orgel des berühmten Orgelbauers Henricus Cumpenius aus dem Jahre 1590 Erwähnung verdient. Aber auch schon aus noch früheren Zeiten sind uns Nachrichten über das Vorhandensein von Orgeln bekannt. Denn der Fritzlarer Stiftsherr Theodor von Hardenberg, welcher von 1352 bis 54 Kantor war, richtete: „das Fest Casaree virginis (8. Mai) als festum organicum (mit Orgelbegleitung) ein".
Die weltliche Musik und das Volkslied werden in der damaligen Zeit ebenfalls in Fritzlar ihre Anhänger gehabt haben. Wurde doch in den sogenannten Bürger- und Lateinschulen der Gesang als Lehrfach geführt. Besonders aber die Zünfte werden in ihren Zunftstuben die Pflege dieses deutschen Liedgutes, wie überall im deutschen Lande, betrieben haben. Hatten doch gerade die Fritzlarer Handwerker starke und gesund denkende Zünfte, welche ein gewichtiges Wort mit in der städtischen Ratsführung sprachen.
Nach neuester Forschung durch den Bibliotheksdirektor i. R. Dr. Denecke, hat sich meine Vermutung bestätigt. Er fand 1974 ein: „Gesellschaftslied, niederdeutsch, mit Noten. Etwa um 1440. Eingetragen in einer Sammelhandschrift theologischen Inhalts.“
`Ich weiß nicht, warum ich mich freue, doch habe ich guten Mut………´
Dombibliothek Ms. 22, 81. 165 v. Herausgegeben von L. Denecke und H. Braun in: Jahrbuch für Volksliedforschung 1976.“
Aus dem Inhalt der Verse fällt das Motiv „Die Gedanken sind frei“ besonders ins Auge. Darum möchte ich den Lesern die deutsche Übersetzung von Herrn Dr. Denecke hier wiedergeben. Übertragung:
„Ich weiß nicht, warum ich mich freue,
doch habe ich guten Mut.
Wie wenig ich mich graue,
ich hoffe, es wird alles gut!
Wer mit mir hoffen möchte,
denn Hoffen gibt uns manche Lust,
der werde mein Geselle
und hoffe mit auf guten Trost.
Man soll sich Trostes nicht begeben,
in Hoffnung wollen wir werden alt.
Die Welt muß in Unruhe leben -
Glück möge es haben in seiner Gewalt!
Glück habe ich gern zu aller Zeit.
Gott schütz' das Glück und gebe Heil
all denen, die da ohne Neid.
Im Sinn wird froher Mut mein Teil,
und denke alles, das ich will,
des mich doch niemand wehren kann.
So treibe ich mein Gaukelspiel,
hab ich auch nichts, ich freu' mich dran.
Man soll sich Trostes nicht begeben,
in Hoffnung wollen wir werden alt. Die
Welt muß in Unruhe leben –
Glück möge es haben in seiner Gewalt!
In der Gemeinschaft will ich sein,
solang mir Bessres nicht beschert,
und treibe so die Kurzweil mein.
Wer weiß, wonach mein Herz begehrt,
das habe ich im Sinne gut.
Beschlossen hab ich bis zum Tod:
Wo Zuversicht und guter Mut,
da kommt die Freude nicht in Not!
Man soll sich Trostes nicht begeben,
in Hoffnung wollen wir werden alt.
Die Welt muß in Unruhe leben -
Glück möge es haben in seiner Gewalt!
Auch die drei großen früheren Fritzlarer Volksfeste, wie der St. Walpurgis-Markt am 1. Mai und der St. Laurentius-Markt am 10. August, ganz besonders aber das frühere weit über Fritzlars Grenzen hinaus bekannte Schützenfest, bei denen wiederholt die hessischen Landgrafen als Gäste erschienen, sind ohne Tanz und Volksmusik gar nicht denkbar.
Noch besondere Erwähnung verdient, gerade in der Hausmusik, das Kloster und Pensionat der Ursulinerinnen zu Fritzlar. Wird doch hier seit über 200 Jahren den Töchtern des ganzen Landes außer der Allgemeinbildung, die gute Hausmusik gelehrt. Eine ihrer berühmtesten Schülerinnen war Bettina von Arnim geb. Brentano, Schwester des deutschen Romantikers Klemens Brentano, der zusammen mit ihrem Manne Achim von Arnim die Volksliedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ herausgab, zu der Frau Bettina auch sicherlich ihren Beitrag leistete.
Fortsetzung
Wochenspiegel Nr. 52/11 vom 29. Dezember 1977, S. 1-2
EIN BEITRAG ZUR MUSIKGESCHICHTE FRITZLARS
von Hans Josef Heer
3. Fortsetzung:
Jedoch Träger der klassischen Musik war und blieb, bis zu seiner Säkularisation im Jahre 1803, das Fritzlarer Musik-Kollegium des St. Peter-Stiftes, über dessen hervorragendes Niveau uns eine Urkunde aus dem 18. Jahrhundert Einblick gibt:
„Im Jahre 1733 feierte man das 50jährige Regierungsjubiläum des Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt. Zur würdigen Begehung dieser Feier komponierte der Alsfelder Präzeptor und Organist Johannes Götz eine Festmusik in D-dur für Streichquintett, Trompeten, Pauken, Orgel und Gesang. In der ersten Probe, am 14. Februar, kam es zwischen dem Komponisten und einem Mitglied des Alsfelder Musikkollegiums zu einem ergötzlichen Streit. Der Präzeptor Götz lief in seinem Ärger zu dem Rat der Stadt und verklagte Rühfel wegen Beleidigung. Dieser, so schrieb er, habe behauptet, daß `das musikalische Stück, die Komposition, von einem anderen Stück genommen und der vorgeschriebene Text darunter gesetzt´ sei, auch habe Rühfel gesagt, die `Stimmen der Pauken und Clarinen´ (Trompeten) sei, `nicht kunstmäßig verfertigt.´"
Um die Richtigkeit seiner Behauptung zu beweisen, holte Rühfel die Gutachten von drei Sachverständigen ein. Er wandte sich unter anderem auch an einen Kompositionskundigen in Fritzlar. Dieser stellte ihm folgendes Zeugnis aus:
„Eine wunderseltsahme, wie auch mir gantz unbekante Sach zu sagen, aber eine unbekante Composition hab ich von Herrn Rühfel von Alßfeldt erhalten, welche mir zwaren im Anfang gantz pompös, weilen selbige mit Clarinen und Pauken gesetzt, vorkam, wie ich aber dieselbige recht durchsehen, fande ich, daß selbige so confus und unrecht gesetzt war, daß ich mich darüber verwundert, warumb ich aber obiges geschrieben, deswegen will ich meine Ursach geben, alß ich habe gefunden, daß die Clarinen und Pauken aus dem D-Fis gesetzt, welche ich mein Tag von keinem Authore weder gesehen noch gehört, und versichere, wann alle Komponisten der gantzen Welt würden zusammenkommen, würde es gewiß keiner unter allen vor guth befinden, dann es kann ja keiner auf der Clarin nach der ordentlichen Application von unten auf etwas anders haben alß C-E-G-C. Kann mir aber Author von selbigem unrecht komponnierten Stück, welches mir Herr Rühfel geschickt, probieren, daß ich hab von unten auff D-F-A-B vel H, so will mich selbst zu dero neuen Information submittiren, was aber anlangt die Pauken, so kann ich versichern, daß jederzeit die eine ins C, die andere aber in das G gestimbt wirdt, und solches beliebe der Author andere Herrn Paukers zu fragen, wann ich mich nun unterstehen darff, so werd ich dem Author von gemelten Clarinen ein wenig Licht geben, alß ich glaube, daß sich hat lassen der Author auff einer Clarin intonirn, welche Intonation auff der Orgel wohl ins D-Fis gestimbt, welche auff der Clarin aus nichts alß aus dem C Bangen, weßwegen sich der Author auch aus dem D-Fis setzen, aber weit gefehlt, dan oben kann er die Application, glaube ich, deutlich genug sehen. Solte aber der Author die oben gesetzte Application, nicht verstehen wollen, kann ihn wohl mit diesem Sprichwort trösten: „Cum pertinacia tuentur errores.“ (Mit Hartnäckigkeit können Irrtümer verdeckt werden). Weitleufftiger die Sach zu beschreiben, halte nicht nötig, indessen aber, dieweilen Herr Rühfel von Alßfeld an mich wie auch an unseren gantzen hiesigen Collegio musicali, worunter sich auch gewißlich Compositionsverständige befinden, ein Attestatum sich ausgebethen, also ihm dieses schuldig wie billig hart sich unser gantzes Collegium musicale alles oben geschriebenes mit täglich(!) seiner eigenen Hand unterschrieben und attestieret, wie auch confirmiret, daß eine solche Komposition unächt und verächtlich sey. Geschehen: Fritzlar, den 24. Marty 1738.
Johannes Friderici, Organista et Componista.
Johann Philippus Ille, Musicus in Fritzlar.
Johannes Henricus Ille, Musicus Frideslanae.
Mauritius Gerardus Kirchhoff, attestor ut intus, qui est director chori Friedeslariae.
Bernardus Kirchhoff, Discantista et instrumentista chori hujus attestor ut supra.
Hermannus Antonius Friederici, Tenorista hujus chori et instrumentista attestor mpr.
Johann Hermann Friederici, Senior, Rector scholarum et musicus attestor ut supra."
„Dieses Zeugnis der Fritzlarer Kirchenmusikanten, das von einer vortrefflichen Sachkenntnis zeugt und auf einen guten Zustand der damaligen Fritzlarer Kirchenmusik schließen läßt, legt Rühfel den Alsfelder Stadtvätern vor. Da er zweifellos im Recht war, so wurde er freigesprochen, gleichzeitig aber bestimmt, daß sich beide `christlich vertragen, friedlich und ohne Passion mit ein ander leben und in der Musique guth harmoniren´ sollten.
Der ganze Vorfall zeigt uns, trotz seines humorvollen Beigeschmacks, die Ernsthaftigkeit und hohe Auffassung, die die damaligen Musikgewaltigen von ihrer Kunst besaßen, er zeigt uns den berechtigten Stolz, mit dem das Zünftige Musikantentum früherer Jahrhunderte über seinem Ansehen und seiner Ehre wachte.“
Wochenspiegel Nr. 11/12 vom 16. März 1978, S. 1-2
KRANKENVERSORGUNG IM MITTELALTERLICHEN FRITZLAR
von Hans Josef Heer
Wegen meiner schweren Krankheit, die sich über ein viertel Jahr hinzog, war es mir nicht möglich, weitere geschichtliche Aufsätze im Wochenspiegel erscheinen zu lassen. Verständlicherweise sind mir in dieser Zeit die Gedanken gekommen, wie es wohl unseren Vorfahren bei ihren Krankheiten ergangen sein mag. So habe ich dann in der reichen Geschichtsliteratur über unsere Stadt einiges von Interesse gefunden, die ich den Lesern gern mittteilen möchte.
Das mittelalterliche Fritzlar war in der ärztlichen Versorgung schon fast modern zu nennen. Wohl aus dem Grunde, daß man in Fritzlar durch die Stiftsschule früh studieren konnte, hatte unsere Stadt die ersten und meisten Ärzte von Hessen. Schon 1132 wird uns der älteste Fritzlarer Arzt „Heinrich“ genannt; ebenso war der erste studierte Bürgermeister einer hessischen Stadt, der 1279 genannte Magister „Koma“, zugleich Arzt unserer Stadt. Der erste bekannte Leibarzt der Landgrafen von Hessen, „Johannes“, stammte ebenfalls aus Fritzlar. Neben den Ärzten war noch eine Anzahl von sogenannten Chirurgen oder Badern vorhanden, welche einfache ärztliche Verrichtungen ausübten, auch lassen sich schon drei Hebammen im 15. Jahrhundert nachweisen.
Die verschiedenen ehemaligen Spitals in unserer Stadt entstanden durch die Vielzahl der Ordensgemeinschaften, zu deren Tätigkeit wegen Ausübung der christlichen Nächstenliebe die Versorgung der Kranken gehörte. Schon im 8. Jahrhundert läßt sich seit der Gründung des Benediktinerklosters in Fritzlar durch Bonifatius diese Tätigkeit durch Handschriften nachweisen.
1436 überliefert uns der Vikar „Conradus de Gudensperg“ Hausrezepte und Gesundheitsregeln aus dem Chorherrenstift, welche im „Archiv für Geschichte der Medizin, Band XIX. Heft 1, 1927“, durch Prof. Dr. Karl Heldmann ihre Besprechung gefunden haben. In ihm werden uns eine große Zahl Heilkräuter und ihre Verwendung sowie ein Teil von Ärzten in Fritzlar nachgewiesen.
Aber die ältesten medizinischen Handschriften, die Dank der Forschungsarbeit des ehemaligen Direktors der hessischen Landesbibliothek Herr Dr. Denecke, die erst in neuerer Zeit in dessen Katalogisierung zur allgemeinen Kenntnis gelangten, geben uns einen guten Einblick in das medizinische Wissen im mittelalterlichen Fritzlar.
Dr. Denecke beschreibt z.B. in seinen Handschriften-Katalog, bei der Aufstellung von Fritzlarer Handschriften 1976, auf Seite 29 unter Nr. 101 bis 105 folgendes:
„Medizinische Wissenschaft und Gesundheitspflege in Fritzlar.“ Die Ärzte im Mittelalter waren vornehmlich geistlichen Standes. Auch das St. Peters-Stift hatte unter den Kanonikern ständig studierte Ärzte, deren Namen und bekannt und deren Bücher uns erhalten sind.
In der Kasseler Bibliothek befinden sich 14 medizinische Handschriften aus Fritzlar. Eine umfangreiche medizinische Sammelhandschrift aus dem 15. Jahrhundert, die die Dombibliothek besaß (250 Blatt, in den Deckeln Brevierfragmente des 13. Jahrhunderts) scheint leider abhanden gekommen sein.
Nr. 101 Epistula (Pseudo )Hippocratis ad Micanetem. Wohl in Fritzlar geschrieben, etwa Mitte des 9. Jahrhunderts. Ein bedeutendes Zeugnis frühster Beschäftigung der Medizin im Fritzlarer Stift. Das Blatt wurde von dem Buchdeckel (innen) einer Handschrift gelöst, die der Fritzlarer Pfarrer Johann Borgholz 15. Jahrhundert der Parochialbibliothek vermachte. Fulda, Bischöfl. Seminarbibliothek. Ms. Fritzlar 1.
Nr. 102 Medizinische Rezepte (13. Jahrh.) in einer Pergamenthandschrift mit theologischen Texten (darunter Petrus Lombardus). Mittel gegen Wechselfieber. Zur Stärkung des Magens. Augenpulver u.ä. „Zur Stärkung des Magens nimm Erdrauch (Pflanze) und zerkleinere ihn und gib's durch ein Tuch und tu einen Löffel Honig dazu und brings überm Feuer zum Kochen und nimm das Oberste und den Schaum ab und laß es über Nacht sich setzen, damit es klar wird, und nimm's nüchtern“. Gebunden vom Fritzlarer Buchbinder „mit den drei Heftzahlen“ (15. Jahrhundert) Dombibliothek Ms. 124, Bl. 97.
Nr. 103 Zusätze zum „Antidotarium Nicolai“ (Arzneibuch des Nicolaus), 14. Jahrhundert. Zwei Blätter aus einer Handschrift des um 1100 entstandenen berühmtesten medizinischen Rezeptbuchs des Mittelalters, mit niederdeutschen Glossen. (Mundarten). Bl. 1 unten: Oleum mandragoratum (Alraunenöl) gegen starke Kopfschmerzen. Privatsamml. Nr. 8. der Kodex, zu dem die Blätter gehören, in Kassel Ms. med. 17.
Nr. 104 Rezepte in einer theologischen Sammelhandschrift (15. Jahrhundert). Darin: Rezept für Wundbehandlungen mit einer Lösung von Alaun (niederdeutsch); übertragen: Mit diesem nachbeschriebenen Wasser kann man heilen eine Wunde an einem Bein oder Schienbein vorn an dem Bein, wie alt auch die Wunde wäre. Das ist bestätigt an Wunden. die waren älter als 25 Jahre. Es folgt die Beschreibung der Zubereitung, bei der größter Wert auf peinliche Sauberkeit gelegt wird. Dombibliothek Ms. 125, 12.
Nr. 105 Zwei Pergamentstücke aus einem deutschsprachigen Arzneibuch (um 1407, hier mit der Überschrift: „Von den pillulen“ wohl Theriak Pillen gegen Pest). Du salt auch m(erken,) wan man pullulas git, so sal man dar nach (slaffe)n. bit man sie aber in wyne oder in andern dinge (n dar, s)o insal man nit dar nach slaffen. Dombibliothek Ms. 125, 12.
Hier werden uns einige Rezepturen überliefert, die schon im Mittelalter in Fritzlar ihre Verwendung fanden. Wie ich von Ärzten erfahren habe, finden diese Grundstoffe noch heute in der Pharmazie ihren Gebrauch. Aber leider gab es auch schon damals „Quacksalber“ (Kurpfuscher), die die Not der Kranken auzunutzen wußten. Von diesen und die furchtbaren Zustände in unserer Gegend werde ich in der Fortsetzung berichten.
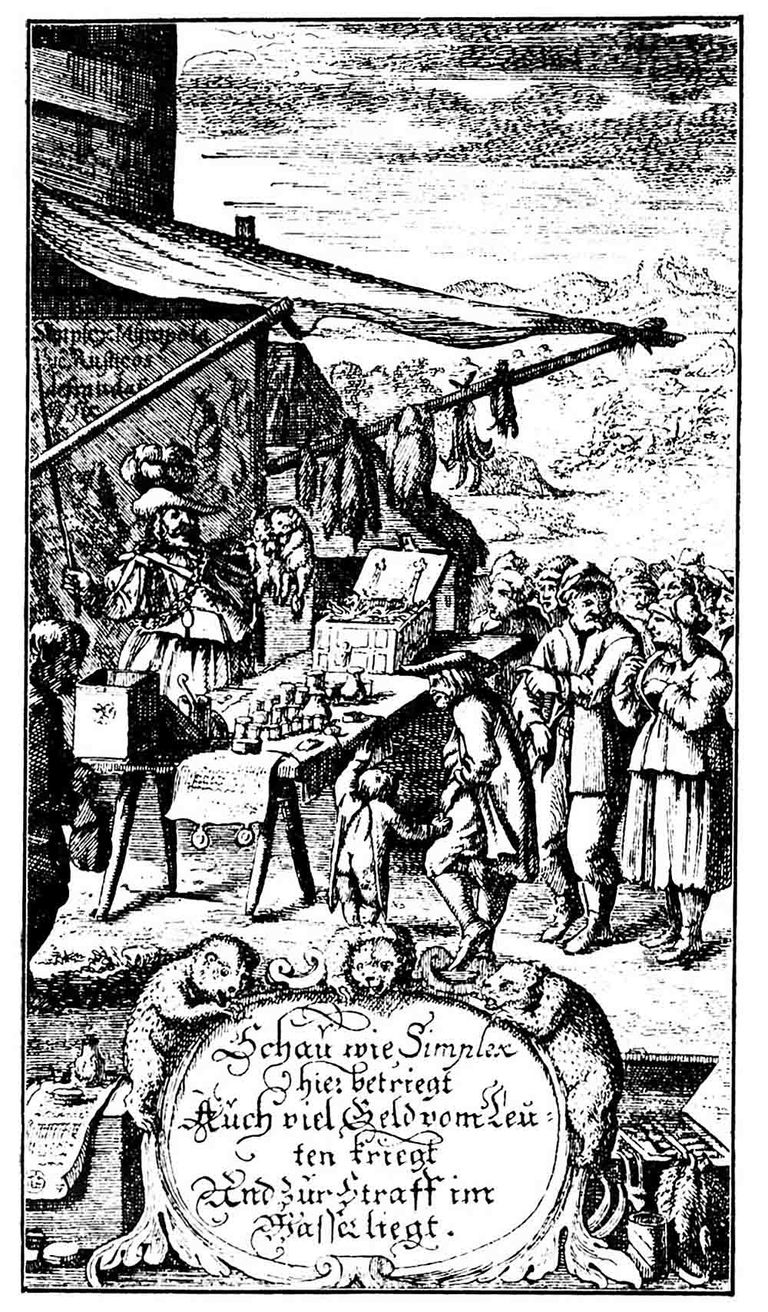
Der Stand der medizinischen Wissenschaft im Mittelalter war eine mehr oder weniger Erfahrungshilfe, die man bei den verschiedenen Krankheiten im Laufe der Jahre gewonnen hatte, sie kann natürlich nicht mit der heutigen medizinischen Forschung verglichen werden.
Wie ohnmächtig man sich fühlte, beweist, daß man durch Kauf von Gebeten Heilung zu finden trachtete. So war lange Zeit der Verkauf von Volksheilmitteln günstige Gelegenheit für alle Schwindler, (Quacksalber, Kurpfuscher), unter denen wir auch den wackeren Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen finden. Bekannt durch seinen Roman „Der abentheuerliche Simplicissimus“, dessen Werk zur Weltliteratur zählt, worin er die ganze Grausamkeit des Dreißigjährigen Krieges schildert, den er ja selbst mit erlebte. Auch Fritzlar hat unter diesem Krieg schwer gelitten. Trotzdem unsere Stadt, wegen ihrer starken Befestigung nicht vernichtet wurde wie die meisten der hessischen Städte, so war doch durch die Pest und die vielen Besatzungen die Bevölkerung auf die Hälfte gesunken.
Aber nicht nur Romane verdanken wir dem hessischen Schriftsteller von Grimmelshausen, sondern auch eine Reihe von Jahreskalendern, wie der Literaturhistoriker Heinrich Kurz herausgefunden hat. In einem dieser Kalender beschreibt Grimmeshausen Interessantes aus unserer engeren Heimat, wie folgt:
„Anno 1635 wurde ich in Knabenweis von Hessen gefangen und nach Cassel geführt / in welche Vestung ein hiesiger Leutenant kam samt zweyen Knechten / beides seyne Beute anzulegen / und seine Verwandten besuchen. Nachdem er sich nun ein paar Tage aufgehalten und lustig gemacht / und nunmehr aufgesessen / sich wieder zu seinem Regiment zu begeben / hängt sich sein Wasser-Hund (der Hund hieß Wasser) den Pferden an den Schwanz und zog zurück / was er zu ziehen vermochte / stellte sich auch sonst gar letz (links, verkehrt). Nach diesem Abschiede kriegten wir in vier Tagen Zeitung (Nachricht) / daß er von den Kayserlichen beschädigt (verwundet) und samt den Knechten gefangen worden.
Die allerletzten Ducat ließ ich zu Cassel wechseln / allwo ich mich zu etlichen Fuhrleuten gesellte / die mit Kaufmannswaren nacher Frankfurt zu fahren willens. Der Weg / den ich noch zu gehen vor mir hatte / war gegen meinem wenigen Geld viel zu weit / mit der Zehrung hinaus zu gelangen / derohalben gedachte ich beyzeiten auf Mittel zu gelangen / mein Maulfutter zu erlangen.
Indem ich mich nun um meine Wegspeise ängstigte / da wurde ohnversehens eines anderen Unglück zu meinem Glück und rückte mir ein / ich sollte wiederum, wie etwan hiebevor in Frankreich, einen Arzt abgeben.
Denn als wir ohnweit Fritzlar in einem Flecken übernachteten/ hatte sich der reichste Mann daselbsten schon dergestalt aus der Nasen verblutet - daß jedermann an seinem Leben verzweifelte. Man war in alle umliegenden Dörfer geritten und geloffen / Leute und Mittel zu suchen / umb das Blut zu stillen; aber das war alles umbsonst! Sobald ich solches von meinem Wirt und meinen Leuten hörete / tat ich mich gleich großer Streich aus / daß ich ihm zu helfen wüßte. Solches wurde alsobald dem Patienten und seinen Leuten gesagt /und ich noch bey eitler Nacht in großer Eil zu dem Kranken selbsten abgeholet.
Denselben fand ich mehr tot als lebendig / denn er sah schon bleich, grün und bleyfarb aus, ohne andere Zeichen des gewissen Sterbens / die sich an ihm spüren ließen. Es stand ein Kübel voll Blut dort / das ich auf 35 Metzen schätzete / ohne dasjenig / so allbereit anderswohin verschüttet worden. Überdas hatten sie so von außen als innerlich allbereit die äußersten Notmittel gebraucht; ihn erschreckt / mit kaltem Wasser begossen / kühlende und zusammenhängende Sachen eingegeben und überschlagen / ihm Schenkel, Arm und Brust wie einem Gefangenen gebunden / seiner mit Aderlassen nicht geschonet und ihn noch darzu hin und wieder am Leib mit angedrückten Schröpfhörnlein (Blutigel) besetzt / auch über Stirn, Nase und Schläfe die gebührenden Sachen aufgebunden.
Es wollte aber alles nicht helfen / sondern es ereignete sich eine Ohnmacht über die andere. Als ich nun sah / wie es war / und der Patient seine Hoffnung und Trost zu mir setzte / befahl ich grad das Widerspiel. Ich ließ ihn mit warmem Bettwerk zudecken / die Bande auflösen / mit dem Reiben seiner Glieder und der Brennung unter den Achseln und anderswo, wo mit Nesseln geschahe, einhalten und nur den Ohnmachten wehren.
Indem sie nun solchermaßen mit ihm umbgingen / nahm ich von seinem Geblüt in eine Pfanne / wischte damit über das Feuer / procediret mit demselbigen nach meiner Wissenschaft und bereitet ihm einen solchen köstlichen Schnupftabak daraus / durch welchen ich ihm vermittels der Sympathia / ehe man hätte hundert zählen mögen / das Blut stellete. Damit nun hatte ich das vornehmste Miracul /größte Wunder) verrichtet und ließ fürder nichts mehr tun / als den Kranken mit herzstimmenden und anderen loshaften Sachen bekräftigen / mit äußerlicher Hülf mit Bettwerk erwärmen und so beschaffenen delicaten Brühlein speisen / daß er sich gegen Tag wieder unter die Gesunden schreiben und ich mit meinen Fuhrleuten meines Weges weiter fortwandern wollte.
Demnach aber des Patienten Hausfrau und seine Verwandten nicht trauten / sondern sorgten / der Zustand würde wieder umbschlagen / also wollten sie den Herrn Doctor nicht hinweglassen / unangesehen ich die Gelegenheit, mit den Fuhrleuten fortzukommen, und die Eilfertigkeit meiner Reise vorwandte. Sie verhießen mir hingegen guldene Berge und versicherten mich / daß in wenig Tagen wieder andere Fuhrleute ankommen und ebendenselben Weg nehmen würden / den die jetzigen vor sich hätten /womit sie mich beredeten / weil ich ohne das Geldes bedürftig war / daß ich noch acht Tage bey ihnen verbliebe / in welcher Zeit der Kranke wieder von Stund zu Stund augenscheinlich an Kräften und lebhafter Farb zunahm.
Das gemeine Geschrey aber von dieser Cur breitet sich dergestalt in einer Geschwinde aus / daß ich in wenig Tagen so einen Haufen Patienten aus den benachbarten Oertern überkam als wann ich der Signor Borri (berühmter Quacksalber des 17. Jahrhunderts) gewesen wäre. Da mußte ich nun tun wie einer / der seinen Credit nicht verlieren will. Was ich an Krankheiten verstand / dafor wußte ich auch Mittel. An welchen ich aber ihre Zustände nicht erkannte / die fertigte ich mit gutem Trost entweder zum Doctor oder Barbierer. Wessen ich mich annahm / der genas gemeinlich / und ich muß schier dafor halten / mehr wegen des guten Glaubens / den sie in mich hatten / als von den Mitteln / die ich für sie brauchte.
Indem kamen abermal Fuhrleute / die nach Frankfurt wollten/ mit denselben eilet ich davon / weil mein verblutet Patient nunmehr wieder bei Kräften und meiner nicht mehr bedürftig war. Er fertigte mich ab mit sechs Reichsthalern / unangesehen er mir im Anfang wohl von hundert das Maul aufgesperrt. Ich nahm verlieb / und weilen ich auch von anderen Kranken bei 4 Reichsthaler verzehret bekommen / gedachte ich solche Hantierung fortzutreiben, das Geld zusammen zu halten und zu solchen Vorhaben mich unterwegs gar genau zu behelfen / damit ich for solches Geld in der nächsten Apotheke allerley Materialien zu' einem Quacksalber-Kram einkaufen könnte“.
Bis dahin folgen wir Grimmelshausen. Man sieht aber, daß die Menschen viel ertragen können, es heißt ja mehr wie ein Pferd.
Wochenspiegel 14/12 vom 07. April 1978, S. 1
Dunkle Rechtsbräuche aus Fritzlars Vergangenheit.
Von merkwürdigen Verhandlungen vor dem Stadtgericht in Fritzlar sei folgendes mitgeteilt:
Im Jahre 1622 ließ Heinrich, der Sohn des Ratsschöffen Veit Cappelen, sein Eheweib malitiose im Stich, brannte durch mit einer Dirne und trieb sich bei den Kriegsvölkern des Mansfelders herum. Im Mai 1623 heimgekehrt, wurde er auf Befehl des Amtmannes Burkhard von Pappenheim arretiert.
Auf Ratsbeschluß sollte er in den grauen Turm gesetzt werden, entkam aber während der Verhandlung aus der Weinstube, stellte sich vor das Rathaus, trotzte mit dem Degen und forderte den Amtmann, ging dann in die Gerichtsstube mit Messer und Degen bewaffnet, blieb nicht vor den Schranken stehen sondern gelangte zu dem Tische, an dem der Amtmann und Schultheiß saßen. Erfuhr sie zornig an, drohte mit den Waffen und fragte, warum man ihn arretiert habe. Er wäre weder Schelm noch Dieb, sondern ein ehrlicher Soldat und diene dem Mansfelder. Als der Amtmann erwiderte, er handle auf bischöflichen Befehl, weil jener sein Eheweib verlassen, „darauf Capeller den Amtmann mit Worten hart überfallen und dermaßen gebährt, als wenn er itzo seinen Gestrengen mit Messer und Degen so er in den Händen hatte, überfallen und ums Leben bringen wollte und sagte, der Amtmann wäre seinem Vater nicht gut, den gedächte er um das Seinige zu bringen, welches ihm nicht angehen sollte, er wäre ein Soldat, diente den Grafen von Mansfeld und keinem König oder Bischof, er diente nicht dem Bischof von Mainz, um denselben scheer er sich nichts, der sollte ihn am Arsche lecken“. Der Amtmann hätte auch vor diesem dem Landgrafen gedient und es wohl danach machen können, daß er ihm noch diente. Hat der Herr Amtmann geantwortet: „Er hätte einen guten Herrn, dem diene er ehrlich, er möchte seinem Herrn auch dienen und verantworten“. So ging es lange auf und ab, da keine Stadtdiener anwesend waren. Erst herbeigerufene Schützen ergriffen ihn a tergo (im Rücken), sonnten hätte er etzliche gar noch entleibt. Als man ihn zum Grauen Turm führte, murrten die Bürger. Reinhard Gunst schrie, man solle die Stadt in Brand stecken, weil die Bürger dem Gefangenen nicht beispringen wollten.
Am 13. Mai 1623 ist Veit Cappelen vor Gericht getreten und hat mit diesen formalibus den Kurfürstlichen Herrn Beamten, Bürgermeister und Rat angeredet: „Ehrgerechte, ehrsame günstige Herrn Beamte, Bürgermeister und Rat! Ich bin von meinem gnädigsten Kurfürst und Herrn zum Schöffenamt erkoren und will in demselben nicht länger sein in Ewigkeit, so wahr mir Gott hilft“.
Als ihn aber der Herr Amtmann fragte, aus welchen Ursachen, hat er sich darauf resolviert, mein Sohn, der ist gefangen mit Spießen und mit Stangen, er hat mir nichts zu Leide getan, hat ers verdient, so tue man ihm sein Recht.
Bis zum 27. Juli 1623 saß Heinrich in Haft, dann leistete er die übliche Urfehde. In dem Schriftstück sagt er, der Erzbischof habe auf untertäniges Bitten seines Vaters und seiner Freunde Gnade walten lassen, obschon er eine andere Strafe an Leib und Leben verdient habe. Er gelobte mit heiligem Eide, Fritzlar und das Mainzer Land 2 Jahre lang zu meiden und während dieser Zeit keineswegs wider die katholischen und andere gehorsame Reichsstände in Kriegsbestallung sich nicht einzulassen, sondern auf der kaiserlichen Majestät oder königlichen Majestät in Hispanien und der Katholischen Seite in Kriegsdiensten sich gebrauchen lassen. Zur Sicherheit stellte er drei Bürgen.
Jahrelang ist aber nach seiner Rückkehr von Exzessen, Gewalttätigkeiten, Schlägereien und Schimpfereien, Mißachtungen jeder Obrigkeit die Rede. Als 1632 er wieder einmal verhaftet werden sollte, ging er mit gezücktem Messer auf die Stadtdiener los und schrie, er würde sie erstechen, wenn ihn jemand anrührender der Teufel sollte ihn mit Leib und Seele hinwegführen. Bürgermeister und Rat ließen ihn darauf nicht in den Turm legen und beschlossen, bei Rechtsgelehrten anzufragen, was zu tun sei.
Erst sein früher Tod machte allen diesen Dingen ein Ende. Man erkennt aus diesem Histörchen, daß es zu allen Zeiten schon Querulanten und Terroristen gegeben hat, die ebenfalls aus den sogenannten besseren Familien stammten.
Hans Josef Heer
Wochenspiegel 15/12 vom 13. April 1978, S. 1-2
Hexenprozesse, dunkle Blätter aus Fritzlars Vergangenheit I
Eine ebenso merkwürdige wie beklagenswerte Erscheinung im ausgehenden Mittelalter ist der Glaube an Hexen und Zauberer, beklagenswert nicht nur als eine traurige Verirrung des menschlichen Verstandes, sondern auch wegen der die Menscnheit entehrenden, für das moralische und bürgerliche Leben so verderblichen Wirkungen.
Viele schlimme Wunden aber schlug der Hexenwahn. Schon früh hatte die Kirche immer und immer wieder erklärt, daG der Glaube an lasterhaften Weibern, die vom Teufel verführt seien, nichtig sei, und Karl der Große hat auf die Greuel, die aus solchem Hexenglauben erwuchsen, den Tod gesetzt. Abeder Glaube an Hexen ist viel älter als das Christentum in Deutschland, auf dem Abscheu vor Häßlichkeit und dem Glauben an Menschenfresserei beruhend, ließ er sich nicht unterdrücken. Schließlich haben auch die Kirchen das Vorhandensein von Hexen nicht mehr geleugnet und alles getan, sie aufzustöbern und auszurotten.
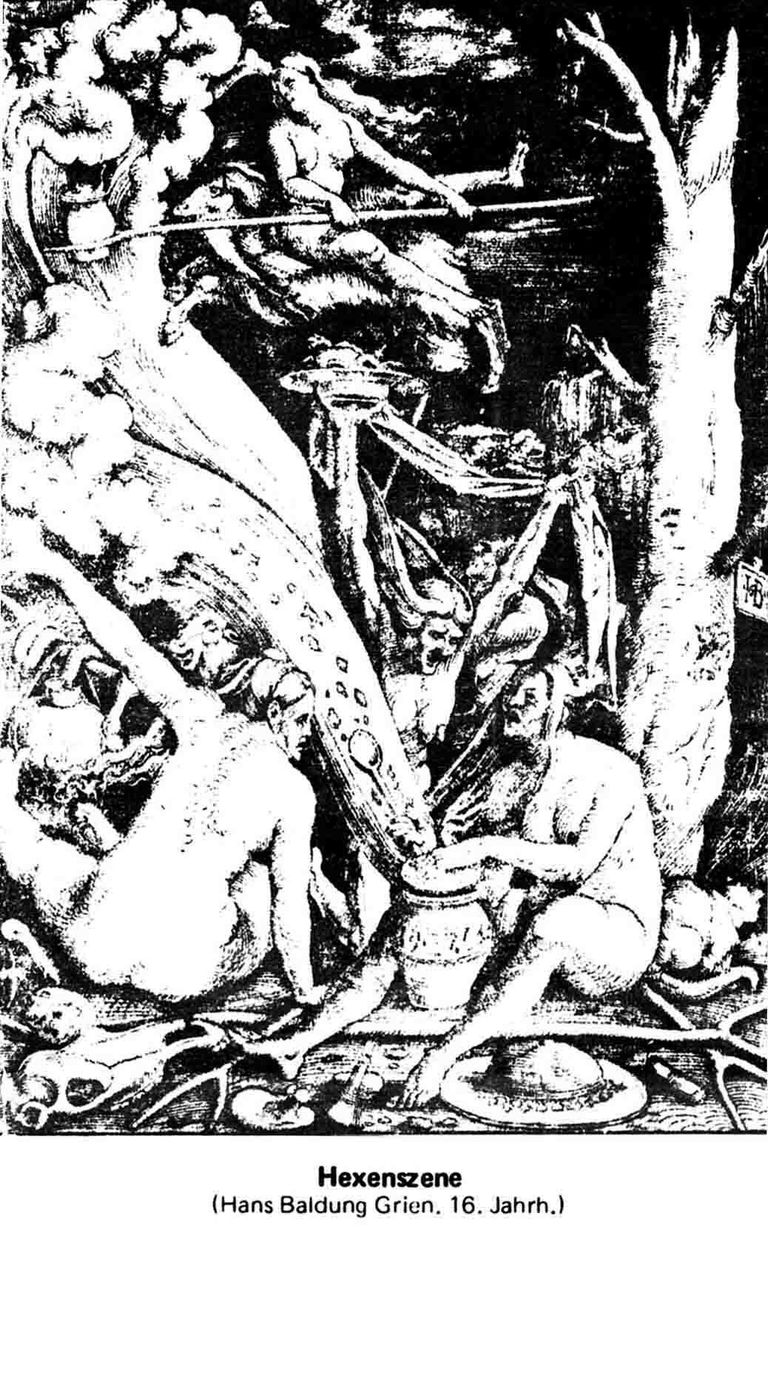
Hexen waren nach der Auffassung unserer Vorfahren menschliche Zauberinnen, die infolge eines Bundes mit dem Teufe; über außernatür-liche Kräfte verfügten und auf zauberische Weise ihren Mitmenschen scha-den konnten. Besonders den Frauen schrieb man eine größere Wesensver-wandschaft mi: den Naturkräften zu. Sie rieben ihren Körper mit Hexensalbe ein und wurden dadurch fähig, in gewissen Nächten durch die Luft zu ihren Versammlungen zu fahren, bei denen der Teufel als Ziegenbock präsi-dierte. Besonders liebten sie den Tanz. Jede Gegend hatte ihren Hexentanz-platz. Am berühmtesten war der auf dem Brocken im Harz, andere fanden sich bei Emsdorf und Hetzbach im Kreise Kirchhain, bei Völkershain am Vogelsberge. Die Hexen haben Triefaugen, rote Haare und meist einen Kropf. Sie nehmen den Kühen die Milch und machen sie blau oder blutig. Kreuze mit Kohle des Osterbrandes gemacht, müssen darum besonders in der Wal-purgisnacht die Ställe schützen. Über dreierlei Eisen läßt man das Vieh schreiten. Die Hexen verzaubern aber auch Bäume, "beschlappern" den Menschen und verursachen Krankheiten, Gebrechen und Ungeziefe . Alle Hexen hassen das Ausspucken. Mit Vorliebe verwandeln sie sich in Katzen und Kröten. Der Teufel sitzt als schwarzer Rabe oft auf ihrem Dache.
Die ihnen zugeschriebenen unheilvollen Kräfte zeitigten neben der Furcht auch Haß im Volke. Seit dem 13. Jahrhundert galt die Hexerei als Ketzerei und wurde von der Inquisition verfolgt. Bestätigt und ausgedehnt wurde die Gewalt der Inquisition für Deutschland durch die Bulle Innocent VIII. vom 5. Dez. 1484. Zu der selben Zeit erschien der berüchtigte Hexenhammer, das allgemeine Gesetzbuch für die Hexenprozesse. Die Tortur fand reichlich Anwendung, durch sie erhielt man alle nur gewollten Eingeständnisse.
Irgendein Muttermal galt schon als Zeichen des Paktes mit dem Teufel. Fühlte die Angeklagte bei Durchstechung der Haut keinen Schmerz, so war sie schuldlos. Als Beweismittel diente auch die Wasserprobe. An Händen und Füßen gebunden, wurde die angebliche Hexe in das Wasser, meist einen Teich, geworfen.
Schwamm sie, so war ihre Schuld erwiesen, ging sie unter, so war sie unschuldig. Das Urteil lautete auf Verbrennung. Den Höhepunkt erreichte die Verfolgung im 16. und 17. Jahrhundert. Neben dem allgemeinen Aberglauben wirkte damals die übertriebene Anschauung von der Macht des Teufels, aber auch niedrigste Leidenschaften wie Geldgier und Rachsucht mit.An Händen und Füßen gebunden, wurde die angebliche Hexe in das Wasser, meist einen Teich, geworfen. Schwamm sie, so war ihre Schuld erwiesen, ging sie unter, so war sie unschuldig. Das Urteil lautete auf Verbrennung. Den Höhepunkt erreichte die Verfolgung im 16. und 17. Jahrhundert. Neben dem allgemeinen Aberglauben wirkte damals die übertriebene Anschauung von der Macht des Teufels, aber auch niedrigste Leidenschaften wie Geldgier und Rachsucht mit.
Aberglaube und Zauberwahn waren der Boden, auf dem die trüben Ausgeburten des Rechtsirrtums der Hexenprozesse auch in Fritzlar gedeihen konnten. Nachdem der Hexenglaube von den amtlichen Autoritäten einmal als berechtigt anerkannt war, konnten ihn die stichhaltigen Gründe und schlagendsten Argumente nicht mehr so leicht aus der Welt schaffen. Noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts, als bereits kräftig der Kampf gegen diesen Aberglauben eröffnet war, flackerte er in Fritzlar noch einmal heftig auf und führte zu einer großen Anzahl schmählicher Hexenverfolgungen und Hexenprozesse mit ihren barbarischen Urteilen.
Eine aus dem Jahre 1615 erhaltene peinliche Indiktionalklage gegen 5 aus Ungedanken nach Fritzlar überführte Hexen zeigt uns in den verschiedenen Punkten den erschreckensten Tiefstand des Hexenwahns damaliger Zeit.
Es heißt dort:
1. Vermittels solcher Protestation setzt und sagt der Ankläger, wahr sei, daß in Gott, Christ und weltlichen Rechten die Zauberei, auch das Vergiften bei
Leib und Lebensstrafe verboten.
2. Wahr, daß auch in der Peinlichen Halsgerichts-Ordnung Caroli V. diejenigen, so den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachsehen zufügen, vom
Leben zum Tod mit Feuer gestraft werden sollen.
3. Wahr, daß die peinlich Angeklagten sich der Zauberei nicht wenig verdächtig gemacht.
4. Dann wahr, daß sie je und allerwege im zauberischen Gericht und für Zauberinnen gehalten werden.
5. Wahr, daß auch peinliche Angeklagten Geschwister und Freunde etliche gleichsam berüchtigt.
6. Wahr, daß peinliche Angeklagte Curt Nodens Frau Wilhelm Singelstein einen bezauberten und einen roten Apfel bei der Lammhütte gegeben haben
soll.
7. Wahr, daß von dieser Zeit an Singelstein bis auf diese Stunde lahm ist.
8. Wahr, daß Singelstein ihr solches untersagt, und siL solches bisher nicht geändert oder verantwortet.
9. Wahr, daß die Scheffersche sie auch dafür gescholten und zur Wasserprobe mit ihnen begehrt.
10. Wahr, daß sich dieses schon allbereits der "Vorflucht" vernehmen lassen.
Die peinliche Indiktionalklage hat 26 Punkte und wird in der nächsten Folge weiter behandelt.
Hans Josef Heer
Wochenspiegel 16/12 vom 20. April 1978, S. 1-2
Hexenprozesse, dunkle Blätter aus Fritzlars Vergangenheit II
Hexenprozesse mit ihren barbarischen Urteilen. Fortsetzung der peinlichen Indiktionalklage aus Fritzlar im Jahre 1615:
11. Wahr, daß das auch mit der Angeklagten Kurt Nodens Frau, dem Greben durch dessen Frau einen harten Taler verheißen, daß sie neben den andere Weibern nicht durfte mehr vorkommen.
12. Wahr, daß dieser Weiber etliche die Mitangeklagte schon auch heimlich "hertrige" (ins Haus) zu solcher Ausflucht bestellt haben.
13. Wahr, daß Steineß Webers Frau die Angeklagte Hans Heinen Tochter Buttermilch gegeben und darin Gift getan, woran sie beinahe gestorben wäre.
14. Wahr, daß diese Person oft für eine Zauberin gescholten und solches ungeahndet hingehen lassen.
15. Wahr, daß hieraus großen Aufruhr und anderes Unglück geschahen.
16. Wahr, daß zu gleicher Zeit bei der Mitangeklagten Hennen Strieder Frau zu Mitternacht unterschiedliche Weiber ein und ausgegangen und heimliche "gewispell" miteinander gehalten.
17. Wahr, daß die Mitangeklagte Hermen Pfaffs Frau in verschiedener Walpurgisnacht auf dem Zaubertanz und den Kranz gewonnen habe.
18. Wahr, daß jetzt gemeldete Mitangeklagte Hermen Pfaffs Frau auf jüngster Walpurgisnacht von Hermen Wageners Birnbaum Blut geholt haben soll.
19. Wahr, daß dieser Baum auf diese Stund nicht trägt sondern dürr wird.
20. Wahr, daß insonderheit Mitangeklagte Hennen Strieders Frau von zauberischen Dingen und Gebeten, Worten und Werken, nämlich von guten Hollen (Geistern), deren Handel, Leben und Wandel gut bescheid weiß.
21. Wahr, daß Mitangeklagte der mitangeklagten Hennen Strieders Frau die Eier aus dem Haus gezaubert haben soll.
22. Wahr, daß die Scheffersche wissen und von guten Hollen gehört haben will, daß mitangeklagte Hans Heinen Frau eine Ente verloren und Hans Heine dieselbe in einem gelben Kessel gekocht haben soll.
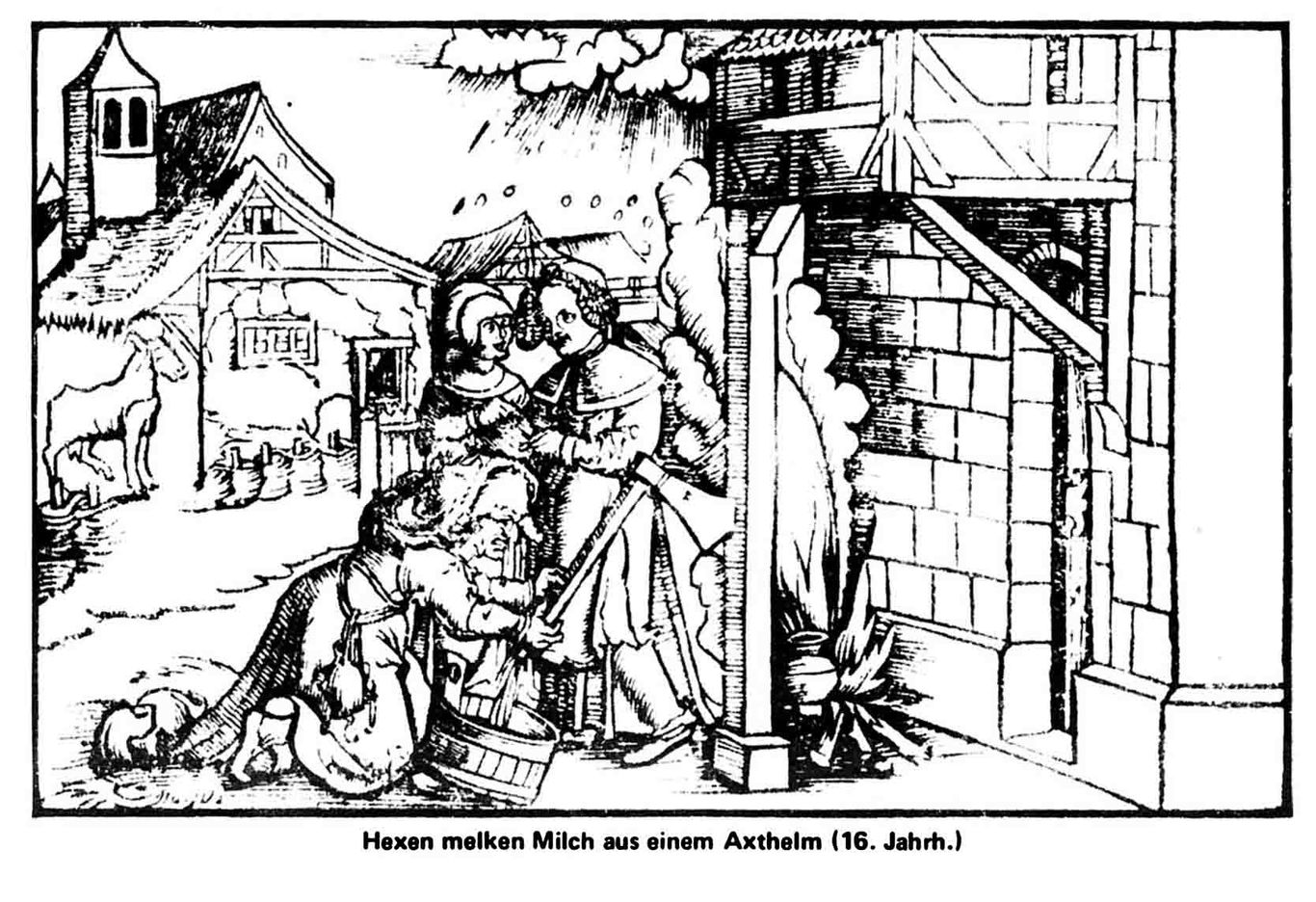
23. Wahr, das Mitangeklagtin Curt Noden Frau mit Henrich Fenneln in Unwillen gekommen und sie sich vernehmen lassen, es sollte gerochen (geräucht)
werden, ehe acht Tage vergehen sollten.
24. Wahr, daß also erfolget und Heinrich Fenneln in der Zeit ein schönes Rind, so sie bezaubert haben soll, gestorben.
25. Wahr, daß die Mitangeklagten alle zusammen zur Beibringung ihrer vermeinten Unschuld zur Wasserprobe provicieret.
26. Wahr, daß Mitangeklagte Curt Noden Frau zwei Männer an Hennen Strieders Frau, auch Mitangeklagte, geschickt und um Gotteswillen gebetet, daß sie entschuldigen und expurgieren wollte, so wollte sie sich mit ihr vertragen usw.
Der Ankläger bittet im Namen der Fürsten, man wolle erkennen und sprechen, daß Angeklagte sich selbst zu wohlverdienter Straffe und anderen zum abscheulichen Exempel als Zauberinnen und Vergifterinnen vom Leben zum Tode hinzurichten, oder sofern sie samt und sonders die Artikel verneinen oder wider ihr Gewissen verleugnen würden, sie wegen haftender redlicher Wahrzeichen, Argwohns, Verdachts und Vermutung zur peinlichen Frage zur Erkundigung der Wahrheit zu erkennen sei.
Die Fritzlarer Hexe Trina Hedding machte nach peinlicher Befragung (Tortur) vor Gericht folgende Aussagen:
1. Daß sie das Zaubern zu Fritzlar von ihrer Brotfrau nebst derselben Töchter, da sie Fastnacht gehalten und sie eben 16 Jahre alt gewesen, gelernt und also 44 Jahre das Zaubern gekonnt habe.
2. Habe sie sich ihrem Buhlen, so ein grünes Kleid, schwarzen Hut und weiße Federn getragen, ergeben und den Herrn Christum verleugnen müssen.
3. Daß ihr Buhle, so einen gespaltenen (Huf) Fuß gehabt und am anderen Glauben gewesen, ihr auf die Treue einen Goldgulden gegeben, so Pferdedreck geworden und sich mit demselben vermischt habe.
4. Habe sie verschiedenen Haustöchtern und Dienstmägden das Zaubern gelehrt.
5. Daß sie auch einer Ehefrau zu Fritzlar das Zaubern gelehrt, welche schwören müssen, Gottes Reich zu zerstören und des Teufels Reich zu mehren, denn sie hätte ihrem Buhlgeist verheißen müssen, sein Reich zu mehren; wäre vom Satan übel geschlagen, wenn sie nicht hätte Schaden tun oder Jemand lehren wollen.
6. Daß sie ihre Schwester Elisabeth,Jost Rauschenbergs Frau, zu Fritzlar bezaubert habe, daß sie gestorben.
7. Daß sie auch eine Magd zu Fritzlar, Elsa genannt, bezaubert habe und solches in einem Trank geschehen sei, hätte lange Zeit krank gelegen und wäre hernach gestorben.
8. Daß sie auch zu Fritzlar einen Müller einen Esel bezaubert hätte, daß derselbe ein Bein zerbrochen.
9. Daß sie auch eines Metzgers Hund zu Fritzlar bezaubert habe.
10. Daß sie auch allhier eine Katze bezaubert habe, hätte auch vergangenes Jahr auf Geheiß ihres Buhlgeistes ihre Schweine sollen bezaubern, so damals nicht geschehen, aber hernach hätte sie einem Schweine vor einem Jahr teuflischen Samen in den Stall geworfen, so tobend geworden.
11. Sei allezeit zu Fritzlar auf dem Zaubertanz, da sie sich zuvor mit Zaubersalbe geschmiert gehabt, zum Schornstein hinausgefahren.
12. Ihr Buhlgeist habe ihr angezeigt, daß, wenn man sie einsetzen würde, sollte sie zur Wasserprobe begehren, so würde sie keine Not haben.
13. Sei oftmals von ihrem Buhlen geschlagen worden, wenn sie keinen Schaden tun wolle,daß sie auch lange Zeit einen Arm nicht regen können.
14. Wenn sie in der Kirche gewesen, hätte sie vorm Teufel Frieden gehabt, wenn sie zum Nachtmahl gegangen, hätte sie Streichen gewärtig sein müssen.
Das waren die Aussagen, die die "Hexen", nur um einer weiteren Folterung zu entgehen, machten. Manches unglückliche Weib und Mädchen wurde in Friular eingezogen und den Schmerzen der Folter und endlich dem Scheiterhaufen überliefert. Die Raserei dieser Hexenprozesse wälzte sich wie ein Meteor über unsere unglückliche Stadt. Allein in einer Zeitspanne von 3 Jahren fielen 62 Personen in Fritzlar dem Hexenwahn zum Opfer.
Wochenspiegel 17/12 vom 27. April 1978, S. 1-2
Hexenprozesse, dunkle Blätter aus Fritzlars Vergangenheit III
Das Würzburger Archiv verwahrt noch ein Verzeichnis der 1627 - 1630 "hingerichteten und in Gefängnissen gebliebener Personen". Es sind diese: Küna Rabeshausen, Elisabett Scherers, Otilia Mitzen, Eyla Seidenstickers, Küna Mausehundt (erhängte sich in Kerker), Otilia Moni der lahme Speckmüllersche, Anna Kleinscheffers, Jakob Sauls Frau, die alte Hessenländerin, Dippel Decker und seine Frau, Mosthennen Frau, die alte Homännsche (im Kerker gestorben), Veydt Cappelens Frau, Lenhardt Ortts Frau, Adam Göbels Frau, der Hessenländerin Schwester (starb vor dem Tribunsl), Michael Axtt, Hans Bernhardts Frau, Gertrudt Eisernheuptts, Bürgermeister Geörgen Merttlichs Frau, Hans Geisen Frau, Jost Hällings Frau, Jacon Mentzlers Frau, Johann Ackermanns Wittib (starb im Kerker), Wilhelm Orts Frau, Johannes Knatzes Frau, Hans Wageners Frau, Hen Rupertts Frau, die alte Hirtsche im Lürloch, Diederich Kahlen Wittib, Hans Körber und sin Frau, Hans Drehers Frau, Michael Axt Frau, Hen Rabelshausen (starb im Kerker), die alte Ziegelersche, Henrich Wagner, Wendel Krausen Wittib, Johannes Brauns Wittib, Johannes Kausen Frau, die alte Badersche, Jakob Mitzen Frau, Merga Oppenheimb, Henrich Fossen Frau, Johannes Seylemans Frau, Engelhardt Scheffer und sin Frau, Peter Scharffen Frau, Johannes Greben Frau, Johann Klübers Wittib, die alte Lindemännsche (starb im Karzer), des Gerwigs Frau (ist ausgerissen), Emanuel Meyers Frau, Stoffel Diederichs Wittib, die Freylendörfsche, Hans Teiffers Wittib, Trin Kuchenbeckers, des Bettelvogts Frau, Martin Kaisers Frau, Johann Sandt."
Zahlreich sind aber auch die Nachrichten über Hexenverfolgungen, die sich zerstreut in den Archiven befinden. Hohe und Niedrige, Arme und Reiche konnten sich nicht vor dieser Raserei schützen. Nicht einmal Kinder waren sicher, von dem Hexenwahn verschont zu bleiben. So erging im Februar 1625 an das Stadtgericht wegen Paul Kistners Zaubereilasters halber verhaffteten Töchterleins - es war 11 Jahre alt - der Befehl des Kurfürsten: Es soll berichtet werden, was für pacta sie mit dem bösen Feind geschlossen hätte und wie hoch sie sich gebunden habe. Da das Mädchen seiner Jugend halber nicht vor Gericht gestellt werden konnte, soll es seinem Vater zurück gegeben werden und diesem aufgetragen werden, es mit notdürftigen Unterhalt zu versehen und nimmer allein zu lassen, allzeit bei Tag und bei Nacht soll jemans bei ihm sein. Auch soll er es durch die patres societ, Jesu oder die Pfarrer fleißig besuchen, kateschisieren und instruieren lassen. Sollte innerhalb 4 Wochen keine Besserung erfolgen, so hätte ihr ad poenam relegationis (zur Strafe der Ausweisung) zu schreiten.
Bloße Beschuldigung genügte zur Eröffnung des peinlichen Verfahrens. So schimpfte man am 20. Juni 1633 Heinrich Cappelen, als ihm eine Kuh gepfändet wurde, Georg Langendorf und seine Hausfrau hätten die Kuh auf Walpurgisnacht mit auf den Tanz genommen und verzaubert; alle beide wären Zauberer.
Das Vermögen der auf dem Scheiterhaufen verbrannten Hexen wurde von den Richtern eingezogen, die ungeheuer hohen Prozeßkosten hatten außerdem die Hinterbliebenen der Unglücklichen zu erstatten und es kam öfters vor, daß die Kosten doppelt erhoben wurden, weil Richter und Nachrichter die Gelder unterschlagen hatten. Es ist ein trauriges und ergreifendes Bild menschlichen Elends und unmenschlichen Leidens unschuldiger Menschen, das sich vor unseren Augen entrollt

. Sie wurden herbeigeführt durch die Beschränktheit und Einfalt der Zeit auch durch die tief gesunkene Sittlichkeit und Moral durch die argen Beispiele einer rohen und verwilderten Soldateska.
Es ist ein trauriges und ergreifendes Bild menschlichen Elends und unmenschlichen Leidens unschuldiger Menschen, das sich vor unseren Augen entrollt. Sie wurden herbeigeführt durch die Beschränktheit und Einfalt der Zeit auch durch die tief gesunkene Sittlichkeit und Moral durch die argen Beispiele einer rohen und verwilderten Soldateska. Wenn man bedenkt daß Fritzlar damals nur eine kleine Stadt mit etwa 3.000 Einwohnerzahl war, dann kann man sich eine rechte Vorstellung davon machen, wie furchtbar der Hexenwahnsinn hier gewütet hat, der in ganz Deutschland nach Tausenden zählende Opfer forderte.
Der Jesuitenpater Graf Friedrich von Spee, der Dichter der frommen "Trutz-Nachtigall" hat in Würzburg in 2 Jahren über 200 Hexen auf den Tod vorbereiten müssen und ist durch die Erkenntnis, daß viele unschuldig seien, zu einem leidenschaftlichen Kämpfer gegen das ganze Verfahren geworden. Welch unsägliches Elend offenbart sich uns hier. "Ich lege", so sagt Spee, "dieses mit einem Eidschwur nieder, daß ich wenigstens bis jetzt keine Hexe zum Scheiderhaufen geführt habe, von der ich nach allseitiger Erwägung vernünftigerweise hätte behaupten könn, sie sei schuldig". "Gar viel werden unschuldig gefoltert, gepeinigt, gegeißelt, geschraubet und mit neuer grausamer, unmenschlicher Marter übernommen; müssen für unleidlicher Größe der Pein auf sich oder andere bekennen, das sie nie gedacht haben: und wenn sie schon tausendmal vor Gott ganz unschuldig sind, wil mans ihnen doch nicht glauben. Hierzu können auch wol kommen unwissende Beichtväter, bei denen sie nicht allein keinen Trost finden, sondern die sie mit ihrer Ungestümigkeit überfallen und innerlich peinigen, mehr als die Schergen selbsten: also daß was die armen Menschen sagen oder klagen, sei alles nichts, so lang sie sich nit schüldig geben; sie müssen mit Gewalt und Zwang mit Recht und Unrecht schüldig sein, es gehe wie es wolle, sonst will man sie nit hören. Es kann ja also kommen, daß kein Heulen noch Weinen, kein Entschuldigen noch Ausreden, weder dies weder das helfe, sie müssen schüldig sein; daß man sie peinige dreimal, viermal, fünfmal, bis sie endlich entweder sterben oder bekennen, oder wenn sie noch ja im Leben bleiben, da kann geschehen, daß man sprach: der Teufel stärke sie und halte ihnen die Zung, daß sie nicht bekennen können, und müssen alsdann ja schüldig sein und als Unbußfertige und Verstockte noch greulicher als sonst hingerichtet werde. 0 Gott, 0 Gott was für eine Gerechtigkeit!". Kein Wunder, daß der 38 jährige Spee nach diesen zwei Jahren ergraut war.
Trotzdem haben wir kein Recht, den Verfolgern der Hexen oder der katholischen Kirche einen Vorwurf zu machen; auch auf evangelischer Seite hat man nicht anders gehandelt, und erst um 1750 ist das Hexenverbrennen zum erstenmal verboten, erst 1782 die letzte Hexe verbrannt worden. Wir stehen hier vor einer ungeheuren Massensuggestion, die aus den kleinsten Anlässen neue Nahrung sog - und wir könne auch heute noch nicht behaupten, daß allenthalben in Deutschland der Glaube an geheimnisvolle, teufliche Künste alter, einsam lebender Weiber oder Männer erloschen sei. Leider aber haben wir gerade in Deutschland im 20. Jahrhundert die Verbrennung von Menschen zur Perfektion gebracht. Es ging damals wie heute, in erster Linie an das Vermögen anderer Menschen zu kommen, und leider hat diese grausame Tätigkeit viel von dem dunkelen Mittelalter genommen, sodaß wir heute wissen wozu Menschen in ihrem Wahn fähig sind.
Zusammengestellt unter Benutzung verschiedener Literatur und der Zeitungsartikel des "Fritzlarer Kreisanzeigers" vom 7. und 9. August 1934.
Hans Josef Heer
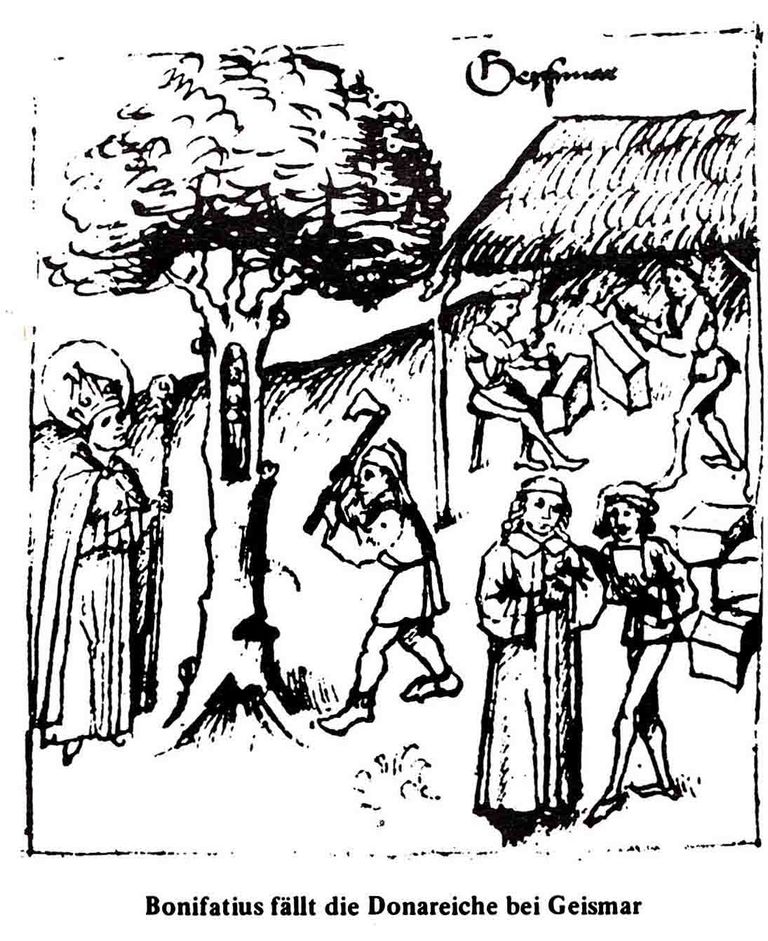
Sehr groß ist die Zahl der Sagen und Überlieferungen, die an Bonifatius und sein Wirken anknüpfen und, ohne Rücksicht auf ihren tatsächlichen historischen Wahrheitsgehalt, beweisen, wie lebendig die Erinnerungen an die gewaltige Persönlichkeit dieses Glaubensboten aus Britannien auch heute noch ist.
Wenn wir zu einer richtigen Würdigung der Wirksamkeit des Bonifatius und der Christianisierung kommen wollen, so müssen wir uns zunächst frei machen von der Vorstellung, daß die heidnischen Germanen in wilden Urwäldern gehaust und keine festen Städte und Dörfer gehabt hätten und daß Bonifatius der erste Missionar des Christentums in dieser Gegend gewesen wäre. Es ist seit langem bekannt, daß gerade der alte Chattengau, also das Gebiet rings um Fritzlar, Gudensberg und Homberg, sehr altes und dicht bewohntes Siedlungsland gewesen ist. Die chattische Hauptstadt Mattium, nach der das heutige Metze seinen Namen trägt und die auf der Altenburg bei Niedenstein lag, wie wir genau wissen und aus den heute noch erhaltenen gewaltigen Anlageresten erkennen, eine große, stark besiedelte Stadt, ehe sie durch die Römer unter Germanikus im Jahre 15 n. Chr. zerstört wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen weit bekannten Städten wird sie von Tacitus bei der Schilderung dieser Kämpfe ausdrücklich als „caput“, als Hauptstadt, bezeichnet. So, wie aber Mattium der politische Mittelpunkt des alten Chattengau war, so war Maden bei Gudensberg, das um 750 als Mathanon, d. h. Versammlungsort oder Gerichts- und Rechtsmittelpunkt. Der Maderstein, die Maderheide und der seltsame Malstein am Dorfrande, der wohl altheidnischen kultischen Zwecken gedient hat, waren die Stätten des chattischen Gaugerichts. Dort aber, wo die Donar-Eiche stand, hat sich zweifellos der religiöse und kultische Mittelpunkt der heidnischen Chatten befunden.
Man könnte versucht sein, ihn vielleicht zunächst nach Gudenberg zu verlegen, da der Name dieser Stadt bis heute die Erinnerung an Wodan, den höchsten Gott der Germanen, bewahrt hat. Dem widerspricht aber die in der berühmten Lebensbeschreibung des Bonifatius, die sein Neffe und Schüler Willibald schrieb, gemachte Angaben, daß Bonifatius die Eiche bei Geismar gefällt hat. Es gibt zwar viele Geismar in Deutschland und mehrere von ihnen bewerben sich um die Ehre, Ort der Eichenfällung zu sein, aber es gibt seit Jahrzehnten in der Geschichtsforschung kaum einen Zweifel darüber, daß nur Geismar bei Fritzlar in Frage kommt, weil hier auch alle anderen Voraussetzungen allein zutreffen. Die großen Ausgrabungen am Ortsrand des Fritzlarer Stadtteils Geismar, die Erforschung einer frühgeschichtlichen Siedlung, deren Anfänge im ersten vorchristlichen Jahrhundert liegen und die bis ins Zehnte Jahrhundert hinein kontinuierlich besiedelt gewesen ist, gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Sie gehört heute zu den größten in Deutschland, wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell gefördert und hat seit 1973 - in diesem Jahr erfolgte die erste Probenuntersuchung - Ergebnisse gebracht, die Wissenschaftler und interessierte Laien aufhorchen lassen.
Ehe Bonifatius in die Fritzlarer Gegend kam, waren bereits seit dem 6. Jahrhundert iroschottische Mönche als Missionare in Deutschland tätig und auch nach Nordhessen gekommen. Durch umfassende Ausgrabungen im Jahr 1926/28 von Professor Vonderau und 1967/71 von Dr. Wand, wissen wir, daß der Büraberg in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten eine starke Grenzfestung der Franken gegen die nahen Sachsen war, deren Gebiet ja bis weit in den heutigen waldeckischen Erdkreisteil hineinragte, und daß sich die Iroschotten auf diesen Berge einen Stützpunkt ihrer Mission gründeten. 723 kam Bonifatius zum Edertat, wo er die erste Massentaufe vornahm: Damals empfingen:, so erfahren wir, „viele Hessen, die den christlichen Glauben angenommen hatten und durch die Gnade des siebenfältigen Geistes gestärkt waren, die Handauflegung.“ Indessen gab es noch sehr viele, die dem alten Glauben nachgingen: „Andere hinwieder waren schon gesunderen Sinnes und hatten allem heidnischen Götzendienst abgesagt. Die rieten und halfen ihm, daß er es unternahm eine ungeheuere Eiche in dem Orte Gaesmere zu fällen, die von altersher bei den Heiden Jupiterseiche hieß. Die Diener Gottes umstanden ihn dabei, aber es kam auch eine große Menge von Heiden hinzu. Die verfluchten ihn untereinander als einen Feind ihrer Götter. Er hatte aber erst wenige Hiebe getan, da wurde die gewaltige Masse der Eiche von einem göttlichen Ehen erschüttert, ihre Krone brach, sie stürzte zusammen und zerbarst wie durch eine höhere Gewalt in vier gleich große riesige Stücke, ohne daß die umstehenden Brüder irgend etwas dazu getan hätten. Als dies die Heiden sahen, die vorher geflucht hatten, da wurde ihr Sinn umgewandelt, sie glaubten und priesen Gott. Der heilige Bischof aber kam mit den Brüdern überein, daß sie aus dem Holze des Baumes ein Bethaus bauen und es dem heiligen Petrus weihen wollten. Als er dies mit dem Beistand des Himmels vollendet hatte, zog er weiter nach Thüringen“. (Nach Zaunert: Stammesurkunde). Das also ist die berühmte Schilderung der Fällung der Donareiche.
Nun befindet sich aber die Kirche St. Petri seit den Zeiten des Bonifatius in Fritzlar. Es hat wohl noch niemals einen Zweifel darüber gegeben, daß der heutige Dom in Fritzlar an der Stelle steht, an der sich die ersten Bauten, die Bonifatius in der alten, wie wir heute wissen, damals schon bestehenden und bedeutsamen Frankensiedlung errichtete. Der Frankenberger Chronist Wigand Gerstenberg erzählt in seiner 1493 begonnenen Landeschronik von Hessen, Bonifatius habe die Donareiche „an der stede“ gefällt, „da itzunt Geißmar lyget uff der Edern. Deß zu eyme gedechteniße so kommen die von Geißmar alle jar geyn Fritzlar unde hauwin eynen boym uff dem Fritzhoffe.“ (Friedhof heute Domplatz). So kommt es, daß Willibald trotzdem von Geismar und nicht von dem ebenfalls schon bestehenden Fritzlar schreibt. Demandt und mehrere Wissenschaftler haben nachgewiesen, daß sich die Gemarkung der heutigen Stadt Fritzlar aus der Gemarkung der vorgeschichtlichen, heute durch Ausgrabung erforschten Geismar entwickelt hat, daß also Fritzlarer Gemarkungsgebiet früher einmal zu Geismar gehört hat.
In der nun folgenden Fortsetzung will ich all die Dinge beschreiben, die noch heute an die über 1250 jährige Vergange heit des Apostel der Deutschen in Fritzlar erinnern.
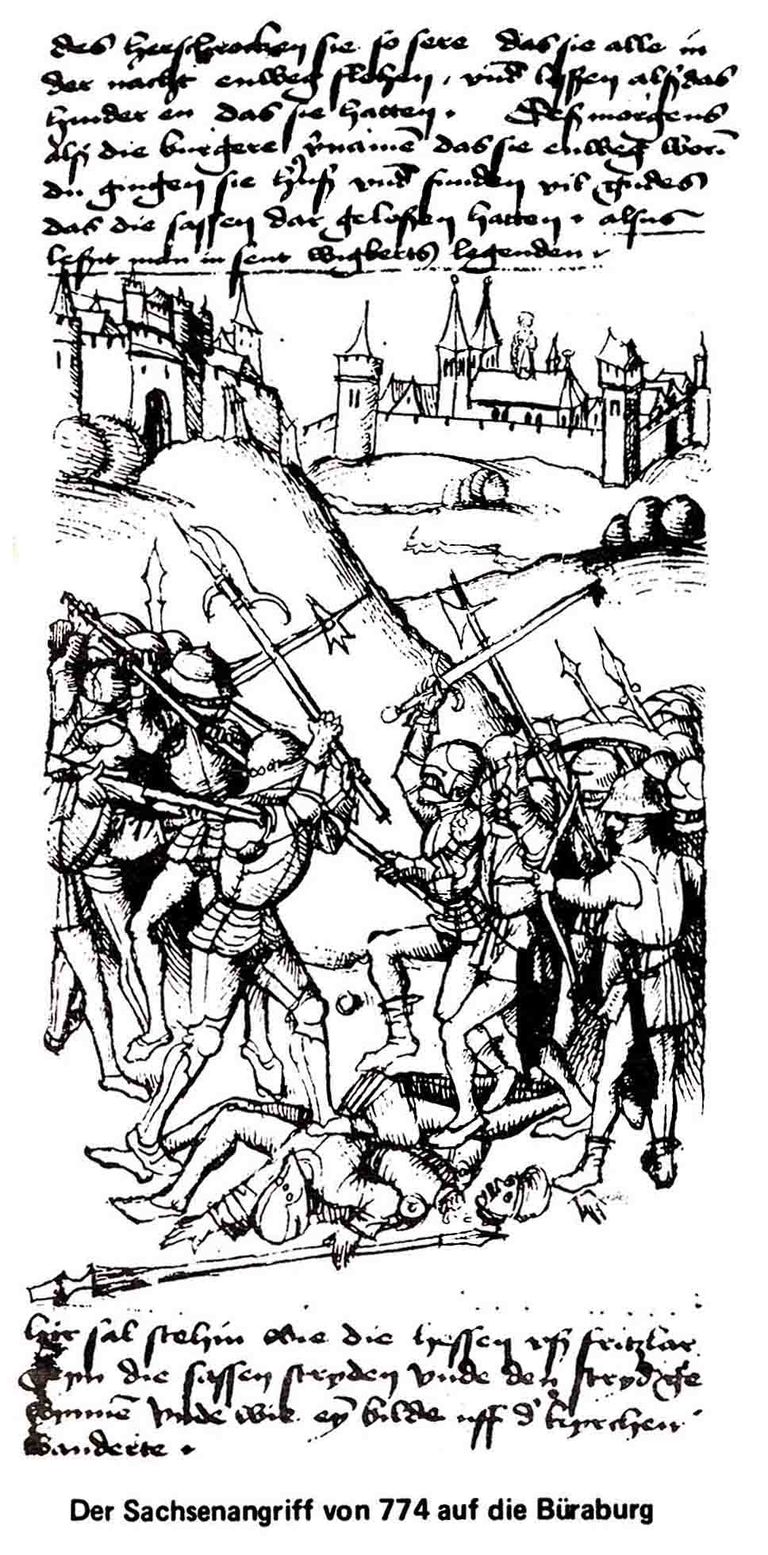
Nachdem nun durch die Fällung der Donareiche das heidnische Glaubenszentrum der Chatten gestürzt war, wurde an seiner Stelle, dort wo noch heute der Dom zu Fritzlar steht, eine christliche Kirche mit einem Benetiktinerkloster errichtet. Bonifatius ließ aus dem Heimatkloster Glastonbury um 730 seinen bewährten Mitbruder Wigbert kommen, welchen er zum Abt und Leiter der ersten hessischen Schule ernannte.
Dr. Wand schreibt in seinem Band "Der Büraberg bei Fritzlar" folgendes: "Seit dieser Tat schritt die Christianisierung Hessens schnell voran. 742 kann Bonifatius endlich sein Missionswerk mit der Errichtung des „Hessenbistum Büraberg“ krönen und abschließen. Er berichtete damals an den Papst Zacharias: „Wir müssen auch Eurer Väterlichkeit mitteilen, daß wir durch Gottes Gnade für die Völker Germaniens... drei Bischöfe bestellt und die Provinz in drei Sprengel eingestellt haben... Ein Bischofsitz, so haben wir bestimmt, soll in der Burg sein, die Würzburg heißt und der zweite in der Stadt, die Büraberg heißt (alteram in oppido, quod nominatur Buraberg), der dritte an einer Stelle, die Erfurt heißt. Diese war ehedem eine Stadt ackerbautreibender Heiden.“ Papst Zacharias hat diesen Bistumsgründungen trotz einiger Bedenken zugestimmt. Seine Bestä-tigungsurkunde für Bischof Witta von Büraburg, einen angelsächsischen Landsmann und engen Mitarbeiter des Bonifatius, ist uns erhalten. Das Hessenbistum hinter den starken Mauern der Büraburg, schloß im Süden noch die Amöneburg ein und grenzte dort gegen das Bistum Mainz. Zwischen Hersfeld und Fulda verlief die Diözesangrenze gegen das Bistum Würzburg, und vielleicht auf der Wasserscheide von Fulda und Werra stieß das Hessenbistum an Erfurt. Nach Norden und Osten waren die Sachsen Grenznachbarn. Vielleicht sollte deshalb Büraburg die Aufgabe eines Missionsbistums für diesen noch im Heidentum verharrendem Stamm übernehmen.
Die Kapelle auf dem Büraberg dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit die älteste Kirche Althessens sein. Hauptpatronin ist die hl. Brigida, die Stifterin des berühmten irischen Klosters Kildare und neben dem hl. Patrik die bedeutenste Nationalheilige Irlands (+523). Sie wurden verehrt als Patronin des bäuerlichen Viehs. Nach den Urkunden traten erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts der hl. Wigbert, der erste Abt von Fritzlar (+746), und der hl. Bonifatius (+754) als Schutzheilige neben Brigida, ohne sie aber als Hauptheilige der Kirche verdrängen zu können. Die Kirche wird 1189 erstmals in den Urkunden erwähnt. Sie ist aber mehr als vier Jahrhunderte älter.
In ihrem heutigen Baustand geht das aufgehende Mauerwerk des Chores der Sakristei und des Westteils mit der Empore in das 13. Jahrhundert zurück.
Noch älter ist der Triumphbogen im Inneren der Kirche; er stammt aus der Zeit um 1000. Die Mauern des Schiffes wurden dagegen nach einer Zerstörung im September 1631 durch Truppen Landgraf Wilhelms V. im Jahre 1692 aber wieder aus Mitteln des Fritzlarer Petersstiftes erneuert. Alles Aufgehende der heutigen Kirche steht auf den Fundamenten eines Baues, der dem von Bonifatius errichteten Hessenbistum von 742 bis 747 als Bischofskirche gedient hat. Jedoch läßt das Brigidenpatrozinium der Kirche vermuten, daß sie nicht von Bonifatius erbaut worden ist. Vielmehr dürfte diese Kirche in der fränkischen Großburg an der Grenze zu Sachsen als Gründung der fränkischen Reichskirche zu Beginn des 8. Jahrhunderts erfolgt sein. In diesem Fall zählt die Brigidenkirche zu den ältesten Kirchen östlich des Rheins.
Die Kirche war im späten Mittelalter Mutterkirche eines Großkirchspiels, zu der die Gemeinden Büraberg, Ungedanken, Rothhelmshausen und Holzheim (heute eine Wüstung zwischen Büraberg und der Bundesstraße 3), Mandern, Wega. Braunau und Wenzigerode gehörten. Im Jahre 1340 hat der Erszbischof von Mainz , Besitzer der Kirche als Nachfolger von Bonifatius, die Brigidenkirche dem Fritzlarer Petersstift inkorporiert (einverleibt).
Für eine erste Orientierung über den Umfang der Burganlage mögen folgende Angaben dienen: Vom Gipfelplateau aus ist der Verlauf der Befestigungsmauer leicht zu verfolgen, denn heute bezeichnet ziemlich exakt die Waldgrenze gegen das Wiesen- und Ackerland die West- und Südfront. Die Mauer im Osten verläuft in der Geländekarte in Höhe der Kreuzstation II. In alten Flurkarten sind die beiderseits liegenden Äcker als „Oberhalb und unterhalb der Ringmauer eingetragen. Die Nordbegrenzung der Burganlage ist der Steilhang zur Eder hin. Der Bering schließt deshalb heute an seiner Nordostecke einen größeren Waldbestand ein.“
Diese starke fränkische Befestigung des Büraberges war in der frühen christlichen Zeit die Fliehburg, bei den vielen Sachseneinfällen, für die Bewohner von Fritzlar und der umliegenden Gemeinden. In den alten Geschichtbüchern aus dieser Zeit wird uns berichtet:
„Die Sachsen selbst fielen aber mit großer Heermacht 774 in die Grenzgebiete der Franken ein und kamen bis zu einer Festung mit Namen Buriburg. Aber drei Grenzlandbewohner gerieten darüber in große Bestürzung und zogen sich, als sie das sahen, in die Burg zurück. Als nun das Sachsenvolk in seiner Wut begann, die Häuser außerhalb niederzubrennen, kamen sie zu einer Kirche in dem Ort Fritzlar, die der jüngste Blutzeuge, der hl. Bonifatius, geweiht und von der er in prophetischen Geist vorhergesagt hatte, sie werden nie durch Feuer verbrannt werden. Es begannen aber die genannten Sachsen mit großen Eifer sich um die Kirche zu bemühen, wie sie sie auf irgendeine Weise durch Feuer vernichten könnten. Unterdessen erschienen einige Christen in der Burg sowie einige Heiden, die bei dem Heer waren, zwei junge Leute auf Schimmeln, die diese Kirche vor dem Feuer schützten und deshalb konnte man weder innen noch außen ein Feuer entfachen oder die Kirche sonst beschädigen, sondern nach Gottes Willen wandte man sich von Entsetzen erfaßt zur Flucht, ohne daß jemand folgte. Man fand aber später einen von diesen Sachsen tot neben dieser Kirche in hockender Stellung, der Feuer und Holz in der Hand hielt, als ob er mit dem Hauch seines Mundes diese Kirche in Brand setzen wollte." soweit die Übersetzung aus den Annalen regni Francorum. In fünf Sachsenüberfällen schützte der Büraberg die unmittelbaren Anwohner vor der größten Kriegsnot, erst durch die Christianisierung der Sachsen verlor die Festung Büraberg seine Bedeutung, und die Einwohner zogen herüber nach den sonniger gelegenen Fritzlar. Das Ende des Bistums Büraberg kam bereits 747, als Bonifatius, nun selbst Bischof von Mainz, das Hessenbistum mit dem Mainzer Sprengel vereinigte. Jedoch hatte das Kloster und das spätere Chorherrenstift St. Peter gleichsam die Erbschaft des eingegangenen hessischen Bischofs von Büraberg angetreten. Heute noch nach zirka 1250 Jahren überkommt den Besucher des Büraberges jene geheimnisvolle Stimmung, die nur die Alten Kulturstätten vermitteln. Er kann noch die Bischofskirche und die zahlreichen Ausgrabungen aus bonifzianischer Zeit an Ort und Stelle besichtigen. Mit den Erinnerungsstücken an Bonifatius im Fritzlarer Dom werden die Spuren seiner Tätigkeit fortgesetzt.
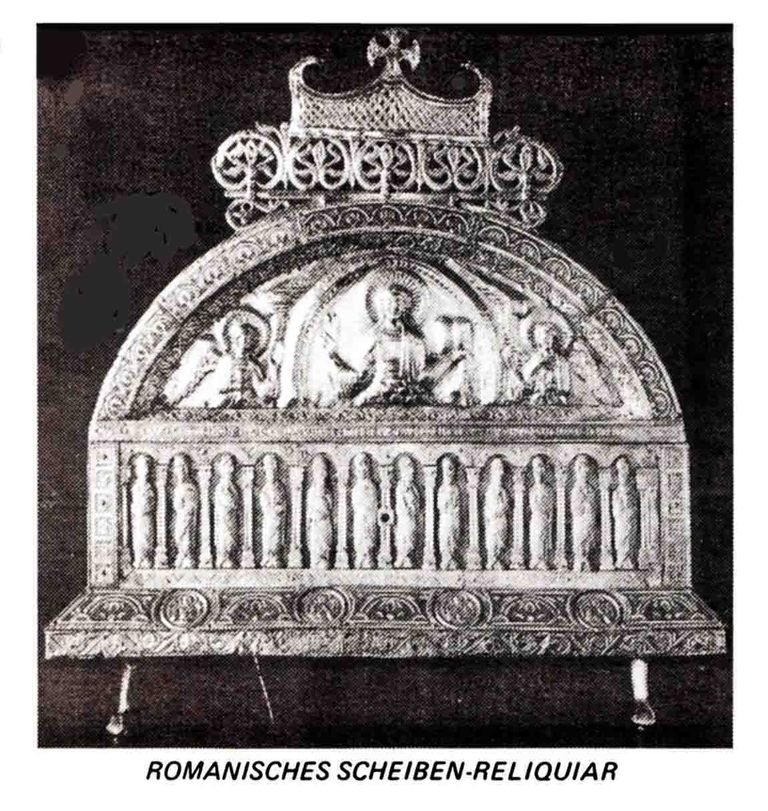
Bonifatius, genannt der Apostel der Deutschen, hat im Fritztarer Dom noch heute reiche Spuren hinterlassen. Der jetzige Dom ist schon der dritte an dieser Stelle, in seinen hauptsächlichen Baumassen etwa um 1180/90 erbaut, jedoch ist immer wieder dabei des Gründers Bonifatius gedacht worden.
Wenn man den Dom von der sogenannten Heiligen-Ecke betreten will so findet man schon draußen in der Nische die Gestalt des hl. Bonifatius. Kommt man ins Innere, so wird zum Blickfang im Chor der wuchtige barocke Hochaltar von 1685, ein Marien-Altar, dessen oberer Aufbau eine Marienkrönung inmitten der Dreifaltigkeit von dem Kirchengründer Bonifatius (mit vom Schwert durchbohrten Buch) und Wigbert (mit Kirchenmodell) umrahmt wird. Im gleichen Chorraum an der linken Seite befindet sich ein barocker Assistenzaltar, wo in Lebensgröße nochmals die Figur des hl. Bonifatius Aufstellung fand.
Bemerkenswert sind die Glasmalereien im südlichen Nebenschiff. Das erste ist ein Bonifatiusfenster und zeigt im Maßwerk die Fällung der Donareiche und die Evangelistensymbole. Das Mittelstück füllen in großer Figur: Papst Gregor, Bischof Witta von Büraberg, Bonifatius und Karl der Große. In den unteren Felden sehen wir die Sendung des Bonifatius durch Papst Zacharias, die Weihe Wittas durch Bonifatius, den Bau der ersten Kirche in Fritzlar und den Lehnseid der Fritzlarer Mönche.
Am westlichen Teil desselben Nebenschiffes befindet sich ein barocker Reliquienaltar, der wurde 1699 - 1703 von Meister Heinrich Pape aus Giershagen aufgebaut als geistlicher Schatzbehälter der Stiftskirche. Die Reliquien, bisher in einzelnen Behältern untergebracht, sollte in dieser originellen Zusammenstellung der frommen Schau und Verehrung dargeboten werden. Beachtung verdienen die beiden romanischen Arme, von denen einer eine bedeutende Reliquie des hl. Bonifatius, der andere eine Armspeiche des hl. Wigbert enthält. Im Kreuzgang hängt neben der Eingangstür zum Dommuseum die beiden Barockfiguren von Bonifatius und Wigbert, eine Arbeit des bekannten Bildhauers Johann Neudecker aus Haddamar von 1724. Im Dommuseum finden wir auf einem Reliquienschrein die Heiligen der Fritzlarer Gründerzeit. Es handet sich um einen reich bemalten hölzernen Reliquienschrein mit dachähnlichen Deckel, der früher im Mittelteil des Reliquienaltars stand. Er entstand um 1470 und wurde wahrscheinlich in Fritzlar hergestellt. Auf den Seitenwänden sind 14 Personen abgebildet, die durch Schriftbänder gekennzeichnet sind, auf der Längsseite je fünf Heilige, auf der Schmalseite drei Könige und ein Papst: St. Wigbert, St. Bonifatius, St. Gregorius, St. Lullus, St. Meingotus, Pipinus, Zacharias, St. Humbertus, St. Albuinus, St. Wicbertus d.j. St. Gothartus, St. Felix, rapo comes, Karolus magnus. Nach der Beschreibung von Dechant Vogel in St. Peter Fritzlar; Seite 48, stellen die Figuren folgende Personen dar: Wigbert, den ersten Abt des Klosters Fritzlar; Bonifatius, den Klostergründer; Papst Gregor II. (715 - 31), der Bonifatius nach Germanien schickte; den Mainzer Bischof Lul, der das Kloster Fritzlar über Karl den Großen mit bedeutenden Schenkungen bedachte; Megingot, der nach dem Tode Wigberts - zusammen mit dem jüngeren Wigbert - für die Fritzlarer Klosterschule zuständig war und später Bischof von Würzburg wurde; König Pippin, als Förderer der Klostergründung; Papst Zacharias (741 - 52); Abt Humbert vom Büraberg und Albuin, der für den Büraberger Sprengel zuständige Mainzer Chorbischof; Wigbert, den jüngeren Presbyter; Felix, den Fritzlarer Mönch, der bei der Bekehrung Sachsens mitwirkte und dort den Märtyrertod erlitt; Heinrich Raspe, den Gegenkönig Friedrichs II., der Fritzlar zum Reichskloster erhoben hatte. Es handelt sich also um Heilige und Herrscher, die sich um Gründung, Entwicklung und Ausstattung Fritzlars verdient gemacht hatten.
Unter dem Dach des Deckels läuft eine Inschrift, die sich auf Wigbert bezieht: hic a sancto bonifatio p(re) positius/i(n) fridilar co(n)stitu/tus est m(a)g(iste)r moribus exemplo / et vita fuit cl arlusl.
Auf den beiden Längsseiten des Daches sind 2 Personen abgebildet, die eine Kirche umrahmen. Auf der einen Seite stehen Eigbert und Bonifatius neben der Fritzlarer Peterskirche, die auf ihrem Dach die Inschrift „pacis doctrina“ trägt. Auf der anderen Seite finden wir Christus und Petrus mit einem Kirchengebäude, das offensichtlich die Peterskirche in Rom darstellen soll, mit dem Spruchband: „Tu es Petrus, in hanc petram ecclesia non conburetur pacis doctrina.“ Es soll hier sicherlich zum Ausdruck gebracht werden: „So wie Christus und Petrus den Petersdom schützten, so soll Bonifatius und Wigbert die Peterskirche in Fritzlar in ihren Schutz nehmen.“ Geht man von dem Dommuseum in den Raum des Domschatzes, so finden wir eines der kostbarsten romanischen Kunstschätze des Fritzlarer Domes, das Scheiben-Reliquiar, welches aus verschiedenen Teilen zusammengefügt wurde. In Stil, Material und Breitenentwicklung stimmen der Sockel und das tympanonartige Bogenfeld überein, das der Aufsatz eines im 1260 gearbeiteten Tragaltärchens zu sein scheint. Der dazwischen liegende Fries mit dem Zyklus der Zwölf Apostel, aus Bein geschnitzt und von viel derberer Qualität sind, mag die Vorsatzplatte eines anderen Tragaltars gewesen sein. Als Bekrönung setzte man mit dem Bindeglied eines gegossenen Palmettenfrieses eine ganz alte Metallarbeit aus reinem Golde auf. Es handelt sich um das Oberteil eines liturgischen Kammes. Solche zuerst im gallisch-germanischen Bereich nachweisbaren Kämme wurden zum Ordnen der Haare nach Anlegen der Meßgewänder und im Ritus der Bischofsweihe nach der Salbung des Hauptes gebraucht. Für die Aufsetzung des Kammrückens auf das Reliquiar gibt es nur eine sinnvolle Erklärung:
Es handelt sich offenbar um ein von Bonifatius überkommenes und darum selbst als Sachreliquie verehrtes Stück. Möglicherweise hat Bonifatius diesen Kamm selbst mitgebracht, oder er wurde ihm zu einer Bischofsweihe vom Kloster aus England geschenkt. Es handelt sich bei diesem germanischen Kunstwerk um eine kunstvolle Arbeit die sich auf den Schnittpunkt zwischen der heidnischen und christlichen Ideenwelt bewegt. Das Germanische Sonnenrad wird zum Kreuzsymbol von zwei Schlangen angespien auf dessen Hals sich zwei Rabenköpfe befinden die als Zeichen Wodans gelten. Typisch für die germanische Ornamentik ist auch die lineare Darstellung von Tieren und deren Einbindung in Schlingenwerk, die auch das wie eine Zierscheibe gestaltete Kreuz durchziehen. Abschließend möchte ich noch auf die Fragmente in der Dombibliothek hinweisen, so ein Fragment aus der spätlateinischen Grammatik des Priscianus. Angelsächsische Schrift des 8. Jahrhunderts, die Grammatiken des Donatus (4. Jahrh.) und des Priscianus (um 500) wurden auch im Mittelalter für den Lateinunterricht in den kirchlichen Schulen benutzt, sowie eine Biblia (Vulgata) Deutsch-angelsächsische Schrift aus dem 2. oder 3. Jahrzehnt des 9. Jahrhundert. Man sieht aus all diesen Dingen wie noch heute die Spuren des Bonifatius in Fritzlar und Umgebung erhalten geblieben sind.
Eine Zusammenstellung aus verschiedener Geschichtsliteratur.

Es war am 29. Juni 1878, als aus dem Reichs-Postamt in Berlin die telegraphische Weisung bei dem Postamt in Fritzlar einlief: Ein Extrapostwagen sollte am nächsten Morgen am Bahnhof zu Guntershausen zum Schnellzug von Berlin gehalten werden. Der damalige Amtsvorsteher hieß Schwalm und Klapp hieß der Posthalter. Dieser wurde veranlaßt, den zuverlässigsten Postillon (Menges), den besten Wagen und die besten Pferde auszuwählen und das Gespann rechtzeitig in Guntershausen zur Verfügung zu halten, was auch geschah. Der 30. Juni brachte herrliches Wetter. Gegen 8.00 Uhr früh fuhr gedachten Wagen vor dem Postlokal in Fritzlar vor und es entstiegen demselben der Herr Staatssekretär des Reichs-Postamts Dr. Stephan, (Schöpfer des deutschen Reichs-Postwesens, Heinrich von Stephan, 1831 - 1897, der erste reichsdeutsche Generalpostdirektor und Gründer des Weltpostvereins (1874), als Handwerkersohn, 1885 geadelt). Der Herr Geheim Oberpostrat Hacke und der Diener des ersteren. Die Herren befanden sich in gehobener Stimmung und es mochte wohl die durchfahrene reizende und fruchtbare Landschaft die nächste Veranlassung dazu gegeben haben. Beim Eintritt Sr. Exzellenz in den Hausflur reichte derselbe dem ihn empfangenden Postmeister die Rechte und begrüßte diesen aufs freundlichste, dasselbe geschah seitens des Herrn Geh. Oberpostrats. Der Herr Staatssekretär war dann so gnädig, den Postmeister nach etwaigen Wünschen zu befragen, deren Erfüllung nach Möglichkeit geschehen sollte. Den Anlaß zu diesem seltenen Wohlwollen mochte die Amtsführung des letzteren und sonstige mit derselben in Verbindung gestandenen Handlung, deren Erörterung hier entbehrlich erscheint, gegeben haben. Postmeister Schwalm lehnte das wohlwollende Anerbieten seines höchsten Vorgesetzten, für seine Person dankend ab, erlaubte sich aber, Sr. Exzellenz den Wunsch auszusprechen, der Herr Staatssekretär möge Veranlassung nehmen, daß das Postamt anderweit sicher untergebracht werde, weil der Zwangsverkauf des angemieteten Posthauses bevorstehe und jenes unter Umständen auf die Straße gesetzt würde. Die Betriebsräume des Postamtes wurden besichtigt und sagte dann Exzellenz: Sehen wir uns die Häuser der Stadt mal an, und dort ging es hin durch die Straßen. Hierbei wurde auch Gelegenheit genommen, die alten Bauwerke, besonders die altehrwürdige St. Petrikirche nebst Kreuzgang zu besichtigen, wobei Sr. Exzellenz hervorragende Kenntnis der alten Geschichte und der verschiedenartigen Baustyle dokumentierte.
Das Ergebnis der Besichtigung war kein zufriedenstellendes, wie ja nicht anders zu erwarten war, denn wie in allen alten Städten, so waren auch in Fritzlar, die Häuser mit ihrer Giebelseite nach der Straße hin erbaut, das Postamt hatte aber viel Gelaß nötig weil noch Personenposten für verschiedene Routen bestanden und die erforderlichen Wagen unterzubringen waren. Nachdem der Postmeister noch den Vorschlag eines Neubaues, neben dem Eingang zur Stadt von Wabern her, unterbreitete, dieser aber mit Rücksicht auf das kostspielige, aus dem alten Wallgraben bestehende Bauterrain abgelehnt wurde, sagte Exzellenz: Es ist die Pflicht der Stadtverwaltung, die Postanstalt entsprechend unterzubringen, und wenn dem nicht nachgekommen würde, so werde das Postamt nach dem nahegelegenen mit ausreichendem Gebäude verlegt werden. Doch besann sich der hohe Herr einen Augenblick und sagte dann: Lassen sie uns das Siebert-Schwingsche Grundstück besichtigen, und es wurden die Schritte dahin gelenkt.
Das aus drei Gebäuden und einem Hofraum bestehende Grundstück gefiel demselben, und auf dessen Fragen, wie teuer dasselbe wohl kommen werde, erteilte der Postmeister die Antwort dahin, daß der Gläubiger seine Forderung von 29000 Reichsmark im Versteigerungstermin sicher herausbieten werde. Exzellenz erwiederte: „Gut, kaufen Sie das Grundstück im Termin, denn dasselbe ist passend für die Zwecke des Postamts, damit Sie aber noch weiter instruiert werden können, sollen Sie mit uns fahren bis Wildungen“. Während der Paratstellung des Extrapostwagens, beehrte der Herr Staatssekretär nebst Begleiter noch die Familie des Postmeisters mit ihrem Besuch, und ging dann die Fahrt nach Wildungen los. Es war eine herrliche Fahrt, während welcher weitere Instruktion erteilt und von den hohen Herren allerlei Erlebnisse mit viel Witz und Humor erzählt wurden. In Wildungen angelangt, wurde zunächst das nahe fertiggestellte, vom Hotelbesitzer Höhle neu erbaute Posthaus besichtigt, dann das Mittagsmahl eingenommen, an dem teilzunehmen, Schwalm die Ehre hatte, und danach zur Besichtigung des Badeortes Wildungen geschritten. Exzellenz war davon sehr befriedigt, und sehr erfreut über die in schönstem Blütenschmuck stehenden Rosenstämme, welche die Vorgärten der Häuser in der Brunnenallee schmückten. Der hohe Herr ließ noch ein Telegramm an den damaligen Ober-Postdirektor, Herr Geh. Postrat in Cassel, wegen der Fritzlarer Posthausangelegenheit abgehen und trennte man sich dann.
Der Herr Staatssekretär nebst Begleitung fuhren über Biedenkopf und Laasphe nach Westfalen, der Postmeister in Fritzlar aber nach seiner Heimat, in dem Gefühl, einen herrlichen Tag verlebt zu haben. Dort angekommen, wurde von ihm ausführlicher Bericht an seine vorgesetzte Behörde erstattet, und einige Tage später kam zu ihm der Herr Oberpostdirektor, um das weitere zu besprechen bzw. anzuordnen.
Fortsetzung folgt
Wochenspiegel Nr. 26/12 vom 20. Juni 1978, S. 1-3
Das reichseigene Posthaus zu Fritzlar und seine Geschichte
von Hans Josef Heer
Nach dem Besuch des Herrn Generalpostdirektors Dr. von Stephan fand demnächst die zwangsweise Versteigerung des angemieteten Posthauses nebst Zubehör statt, in welcher der Postmeister den ihm erteilten Auftrag erledigte. Auf erstattete Anzeige erhielt er dann die Kaufsumme von 29.000 MK und zahlte dieselbe bei dem Königlichen Amtsgericht ein. Mit dieser That waren alle vorher in Aussicht gestandenen Mißstände beseitigt.
Nicht lange währte es und es erschien der Herr Post-Baurat Cuno, um das neu erworbene Posthaus zu besichtigen, und die nötig erscheinenden baulichen Änderungen zu veranlassen. Dies hatte zur Folge, daß einige Betriebsräume umgebaut wurden, wobei sich aber herausstellte, daß das Gebäude recht gebrechlich war. Letzterer Umstand gab Anlaß dazu, einen Neubau in Aussicht zu nehmen.
Die Vorbereitungen nahmen längere Zeit in Anspruch. Im Jahre 1880 wurde das Postamt in das Schwalm'sche Haus in der Allee verlegt, dann die vorhandenen Gebäude niedergelegt und der Bauunternehmer Seiffart aus Cassel mit dem Neubau beauftragt. Der erste, auch dem Postmeister zur Begutachtung mitgeteilte Entwurf, welcher rein gothische Formen mit hohem Turm für die von zwei Straßen gebildete Ecke zeigt, erhielt nicht die Genehmigung des Reichs-Postamtes, wogegen der zweite Entwurf im Renaissancestyl gehalten, genehmigt wurde und zur Ausführung kam. Bauleiter wurde Herr Regierungs-Baumeister Schellenberg.
Bei dem Ausgraben der Fundamente fanden sich Mauerreste von der einstmals hier gestandenen Clobeskirche (Nikolauskirche), und auf dem Gelände des ehemaligen Kirchhofs eine Menge menschlicher Schädel- und Knochenreste vor. Letztere wurden auf den jetzigen Totenhof überführt und in ein gemeinsames Grab gebettet.
In den darauf folgenden Jahren war der Neubau soweit gefördert, daß das Richtefest gefeiert werden konnte. Herr Seiffart bestimmte dazu den 19. November und ließ eine Menge Einladungen (auch an viele Casseler Herren) ergehen. Statt gewöhnlicher Karten hatte er große Blätter, mit der Ueberschrift:
"Einladung zum Richtefest des newen Postgebewdes zu Fritzlar“, der Abbildung des neuen Posthauses und folgenden in altdeutschen Lettern aufgedruckten Worten versehen, versandt:
„Also mit gunst! Ehrsame genossen so da sind beruffen zu der Post oder der Bawkunst edlem würken, seyen hiemit feierlichst zu sothanem Fetse invitiret. - Sie werden entboten am Tage St. Elisabeth, da man schreibet den 19. November anno domino 1881 mittags um die vierte stunde zu feierlicher Versamblung in die altehrsamen mawern der frumben stadt Fritzlar, auf dass nicht handwerksbrauch und gewohnheit der richtekranz mit ziemblicher red möge aufgesetzet werden. - Nach sithan vollbringen soll im Engelländischen Hofe (heute Kaiserpfalz) ein simpel nachtmal angerichtet sein, so denen ehrbaren genossen unter allerley Kurzweil enträchtiglich möge munden! Also mit gunst!“
Die mit verzierten Rändern versehenen Einladungs-Blätter bildeten ein hübsches Geschenkblatt für die Teilnehmer an dem fröhlich verlebten Feste.
Im Spätsommer des Jahres 1882 wurde das inzwischen fertiggestellte Posthaus nebst Hintergebäude bezogen und bei dieser Gelegenheit eine kleine Feier veranstaltet, die in einem Dank-Telegramm, welches an den Herrn Staatssekretär des Reichs-Postamts, und in einem solchen, welches an den Herrn Ober-Postdirektor in Cassel abgelassen wurde, auslief. Das Oberhaupt der Stadt Fritzlar, Herr Bürgermeister Kraiger, betheiligte sich in voller Würdigung der neuen, seiner Vaterstadt eine große Zierde bietenden Schöpfung des Herrn Staatssekretär Dr. Stephan an beiden. Das Hauptgebäude, welches sich in dem einen Flügel nach der
Werkelgasse (heute Gießener Straße) und in dem anderen nach der Clobesgasse (heute Nikolausstraße) ausdehnt, ist im Renaissancestyl aufgeführt und macht einen schloßartigen Eindruck.(?)
Der untere Stock enthält, zweckmäßig eingerichtet, die umfangreichen Räume für den Dienstbetrieb und das Arbeitszimmer des Amts-Vorstehers, während in dem darüber befindlichen Stock zur Wohnung des letzteren, große helle Zimmer nebst Küche und Speisekammer, sich vorfinden. Das Dachgeschoß enthält große helle Bodenräume. Mehrere große Souterrainräume dienen zur Aufnahme des Brennmaterials für das Amt und seine Vorsteher, und die übrigen zur Bergung der Winter- und Bedürfnisse der Familie des letzteren.
Eine Inschrift in großen goldenen Lettern an der Eckfront, besagt den Zweck des Hauptgebäudes, an dem auch eine Abends erhellte Uhr als Zeitbestimmer für das korrespondierende Publikum eingebaut ist. Ein hübscher, mit einer Mauer umgebener Hof mit Wagenremise im Hintergrunde, schließt sich am Hauptgebäude an.
(Ende des Artikels aus dem damaligen Fritzlarer Kreisanzeiger.) In der Fortsetzung die Geschichte des Fritzlarer Postwesens im Mittelalter.
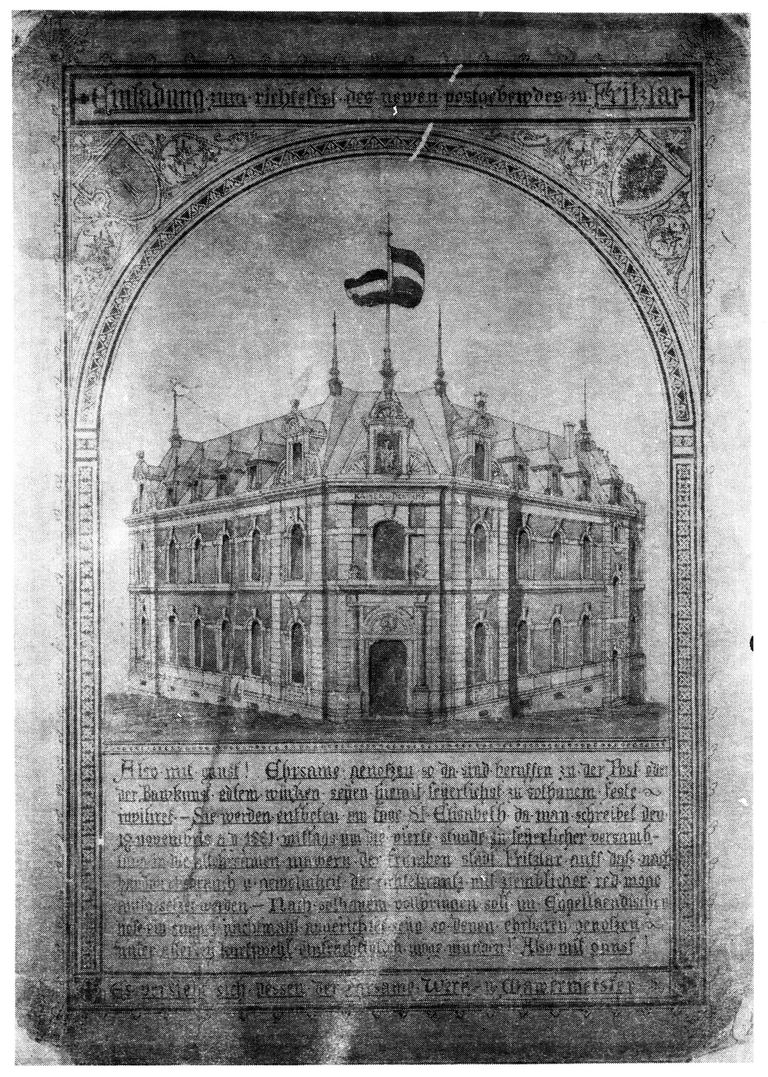
Wochenspiegel Nr. 27/12 vom 06. Juli 1978, S. 1-2
Geschichte des Fritzlarer Postwesens im Mittelalter
Hans Josef Heer
Von der Bedeutung Fritzlars als Straßenknotenpunkt unweit der sächsischen Grenze, die schon von den Merowingern durch die mächtige Bergfeste Büraburg gesichert wurde, darf es als selbstverständlich gelten, daß nicht nur der Berg selbst, sondern auch das verkehrstechnisch wichtige Vorgelände mit Fritzlar in königlichen Besitz gelangte und daß dieser Ort dann auch als wichtiger Ausgangspunkt für die damals reitenden Boten des von Bonifatius gegründeten Benediktinerkloster Fritzlar diente, wie denn auch in dieser Zeit in erster Linie Klosterbrüder, Pilger und allerlei fahrendes Volk die chrichtenvermittlung bedienten. Wir wissen, aus der Frühzeit der Fritzlarer Geschichte, daß nicht allein Bonifatius, sondern auch Fritzlars erster Abt St. Wigbert und Büraburgs Bischof Witta zahlreiche Briefe schrieben, die auf diese Weise befördert wurden.
Einst mit der Entwicklung Fritzlars zur Stadt und zum Handelsmittelpunkt in Nordhessen entstanden besondere Botenanstalten zum Nutzen der Kaufleute, die ihren Handel nachgewiesenermaßen bis nach Flandern und bis in die Ostgebiete ausdehnten. Auch sie besorgten die Vermittlung von Nachrichten und Briefen, insbesondere auch des Kollegiatstiftes St. Peter, das mit Mainz eng verbunden war.
Man kann aufgrund dieser Tatsache annehmen, daß ein mehr oder weniger regelmäßiger Verkehr schon im 13. Jahhundert im Gange war. Doch alle diese Verbindungen entbehrten der Rechte und Pflichten einer öffentlichen Anstalt, wie der Sicherheit und Bequemlichkeit unserer modernen Straßen und diente vorzugsweise den Interessen der Kaufleute und der Landesherren.
Erst dem Geist des Reformationszeitalters war es vorbehalten, den Verkehrsanstalten in Deutschland, die sich inzwischen in vielen Orten gebildet hatten, einen gemeinnützigen Charakter zu geben. Im Jahre 1516 gründete Franz von Taxis, vom Kaiser Maximilian 1. dazu veranlaßt, die erste wirkliche Post zwischen Wien und Brüssel. Franz von Taxis selbst wurde zum niederländischen Generalpostmeister ernannt. Der Erfolg dieses Versuches ermunterte zu weiteren Unternehmungen, die von verschiedenen. Reichsfürsten ausgingen. Die Landesfürsten, wie auch der für Fritzlar zuständige Kurfürst und Erzbischof von Mainz, nahmen bald die Posthoheit für ihre landesherrlichen Gebiete in Anspruch. Die ältesten Posten in Fritzlar in der Zeit des späten Mittelalters waren Botenposten. Die Boten führten keine bestimmten Wege aus, sondern wurden nur nach vorhandenem Bedürfnis verwandt. Damals brauchte ein Bote nach Mainz mit seinem Pferde 36 Stunden.
Damals gab es drei reitende und 16 gehende Boten der Alt- und Neustadt Fritzlar. Sie sind uns namentlich in sogenannten Botenregistern überliefert worden. Diese Register geben auch Auskunft über die Häufigkeit ihrer Verwendung, ihre Bezahlung, die von Fall zu Fall erfolgte, ihr Reiseziel und manches Interessante über das damalige Postwesen selbst. In den Registern und Rechnungskonzepten des erzbischöflichen Kommissars und Kellners in Fritzlar, Konrad Schaufuß, über Ausgaben und Einnahmen aus Kommissariat und Kellnerei werden uns nicht nur die Boten, die wichtige Briefpost besorgen müssen, mit Postziel und Botenlohn genannt, wir erfahren darüber hinaus auch oftmals den Inhalt der Briefe oder zum mindestens, was es mit den zu befördernden Briefen auf sich hat. Denn damals gab es wohl noch nicht das strenge Briefgeheimnis wie heute. Später werden uns sogar auch die Namen dieser Briefträger genannt. Von einer Anzahl von Briefen der Jahre 1425 und 1426 sind die An- und Absender sowie der Inhalt der Briefe überliefert. In dem Register über die Verteilung des Admissionsweines anläßlich der Aufnahme des Dr. Meden aus Göttingen als Domizellar in das Fritzlarer Kapitel St. Peter vom 8. März 1453 werden 16 Boten namentlich genannt. Sie erhalten jeder 1/2 Stopa Wein (2 Liter).
Es sind: Henne Bishouff, Werner Swarczhoubet, Berthold Rudolff, Hene Talis, Poppe, Gotha, Rotermunt, Henne Felkener, Philesmed, Hans Doring, Henne Lineveber, Henne Haynrad, Henrich Fleming, Hencze Schelmann, Henrich Wydolt und Henne Bulon.
Schon unter Landgraf Philipp, waren mehrere Postlinien im umliegenden Hessen eingerichtet. Eine dieser Linien führte über Kassel, Fritzlar, Marburg nach Frankfurt, wo der ehemalige Hainer Hof (heute Hochzeitshaus) für Postzwecke bestimmt war. Im Jahre 1544 ordnete der hessische Landgraf die Post von Kassel nach Frankfurt und weiter nach Speyer an.
In der Stadt Fritzlar beschlossen am 11. Januar 1622 Bürgermeister und Rat: Ihrer Fürstl. Gnaden zu Hessen damit man ihr gratificire, (zusage) das ein ehrbar Raht ain undt das Capitell auch ein Pferdt ihrer Fürstl. Gnaden auf die Post halte.
Schon 1615 wurde die Frankfurter Postzeitung in Fritzlar von den Stiftsherren gehalten. 1649 das Abonnement erneuert. Im Jahre 1646 zahlte die Stadt wegen der wöchentlichen Post zwei Reichstaler. Und im Jahre 1647 zahlte sie für die Beförderung eines Briefes nach Frankfurt 4 Albus (etwa 1 DM) „Bottenlohn“. So blieben die Verhältnisse in Fritzlar bis zum Jahre 1700. Kurz vorher muß eine regelrechte Postanstalt in der Ederstadt eingerichtet worden sein, denn wir finden von diesem Jahre an bis zum Jahre 1803 die Fritzlarer Bürgermeisterfamilie Brotzmann mit der Posthalterei von Mainz aus belehnt.
Auszüge einer Forschungsarbeit von K. J. Thiele
Fortsetzung folgt
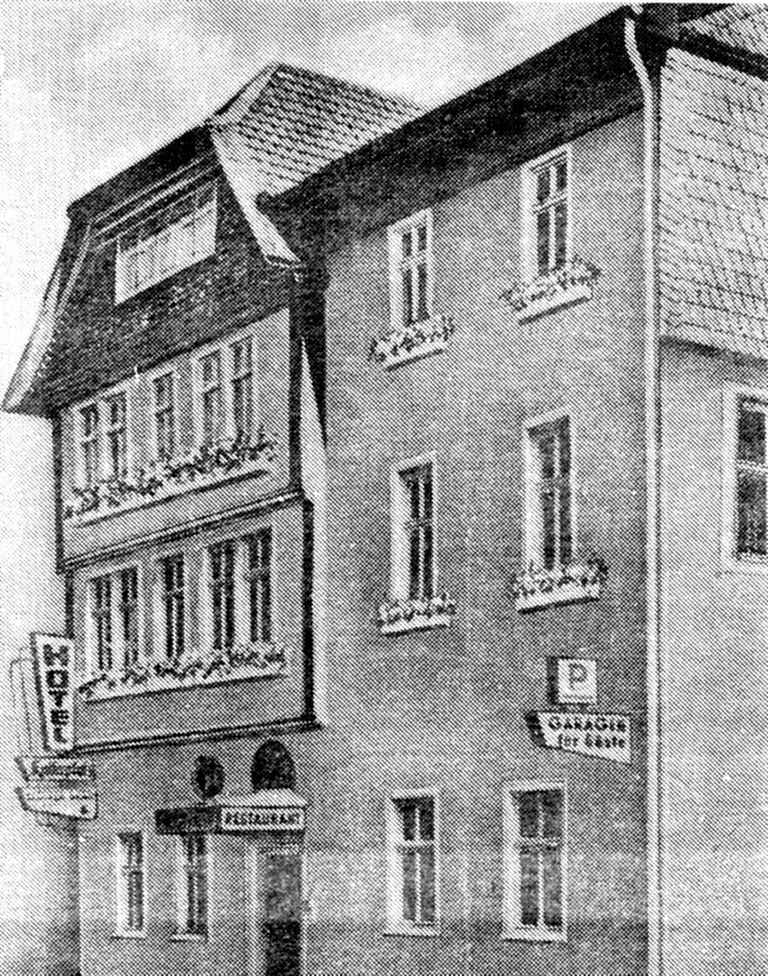
Am 3. Juli 1700 erfolgt an die Stadt ein kurfürstlich mainzischer Kammerbefehl, dem Posthalter Brozmann die verlangte Personalfreiheit zu gewähren, da alle Posthalter im ganzen römischen Reich in personalibus frei seien. Am 24. Oktober 1700 berichtete Bürgermeister Brozmann, kurfürstlich mainzischer Posthalter, an den Rat der Stadt, der hessische Postmeister Ulot wolle die Station der reitenden Post von Fritzlar nach Werkel verlegen. Der Rat möge zusehen, wie dem Schaden begegnet werden könne. Angeblich soll der Einsturz eines Bogens der Ederbrücke, zu dessen Wiederaufbau Hessen den Beitrag verweigerte, die Veranlassung gewesen sein. Die Verhandlungen zogen sich bis zum Jahre 1704 hin, führten aber zu keiner Einigung.
Die Fritzlarer Poststation kam tatsächlich nach Werkel, wo der Posthof heute noch bekannt ist. Er fand sich lange in den Händen der Familie Rohde. In ihm soll König Karl XII. auf seiner Rückreise von Belgrad nach Schweden eingekehrt sein und einen silbernen Becher versetzt haben. Von Werkel führte von jetzt ab die Poststraße mit Umgehung des mainzischen Gebietes direkt über Wabern nach Kerstenhausen und von dort nach Marburg.
Ende des 18. Jahrhunderts wurde die von Mainz und Frankfurt in Amöneburg eingehende Post von dort durch reitende Boten zweimal in der Woche, sonntags und mittwochs, nach Fritzlar befördert. Am folgenden Tage kehrten die Postboten nach Fritzlar zurück. Die Pferde wurden in Gilserberg gewechselt. Im Jahre 1657 ritt die Strecke von Fritzlar bis Gilserberg ein Johannes Schneider, der sich eines Tages im Wirtshaus zu Jesberg betrank und vom Pferde fiel. Er zerbrach das Briefpaket, zerriß die Briefe und warf sie auf die Straße. In den 1820ern Jahren hatte Fritzlar täglich Reitpost und wöchentlich Fahrpost. Nach Naumburg ging ein Postbote.
Vom Posthof in der Werkelstraße, der aus zwei Häusern, C 119 und C 120 mit Stallungen, Remisen, Scheunen und Hofräumen bestand, gingen folgende Postlinien aus:
1. Fritzlar - Wildungen
2. Fritzlar - Naumburg - Wollhagen
3. Fritzlar - Zwesten - Jesberg - Gilserberg - Marburg
4. Fritzlar - Gudensberg - Kassel
5. Fritzlar – Wabern
Die Post wurde früher oft überfallen und ausgeplündert, wobei die Postboten oft ihr Leben lassen mußten. So wurden im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zwei Postboten bei Fritzlar überfallen und ermordet, ihre Leichen am Roten-Hals beim Dom begraben. Zahlreiche Überfälle ereigneten sich auch im 30-jährigen Kriege. 1667 beispielsweise bei Gudensberg von umherstreifenden Reitern und auch in den späteren Jahren wird oft von Überfällen auf Postboten berichtet.
Das hessische Postwesen führte vielfach zu Streitigkeiten mit der kaiserlichen Post in Fritzlar. Den Ursulinerinnen gewährte die Thurn- und Taxische Post auf ihr Ansuchen durch Schreiben d.d. Brüssel im Jahre 1727 eine Reihe von Vergünstigungen. Auch das hessische Postwesen ging durch Vertrag vom 1. April 1816 an das fürstliche Haus Thurn und Taxis über.
Der alte Posthof in der Werkelstraße unterhielt 7 Postillione mit je 4 Pferden. Außerdem 2 Pferde für die sogenannten Felleisenkarren (Briefpost).
In Fritzlar befand sich der kurmainzische Posthof im Hause der jetzigen Kaiserpfalz, früher englischer Hof genannt. Posthalter waren Johann Brozmann, der 1669, 1671, 1672, 1675, 1677, 1681 und 1682, Hermann Brozmann, der 1694, 1696, 1700 und 1702, Johann Brozmann, der 1703 bis 1706 und 1707 das Bürgermeisteramt der Stadt Fritzlar bekleidete. Die Familie Brozmann blieb im Besitz der Posthalterei bis zur Säkularisation, bis zur Ernennung des kurhessischen Postmeisters Homberg. Die Namen der Fritzlarer Postmeister sind von diesen Zeitpunkten an Homberg und seine beiden
Söhne 1804 - Okt. 1843
Wagner 1843 - 1853
Veith 1853 - 1868
Schwalm 1. 8. 1868 - 31.12. 1885
von Fischer 1. 1. 1886 - 30. 4. 1900
Viehsohn 1. 5. 1900 - 28. 5. 1902
Jung 1. 9. 1902 - 30.11. 1908
Vehling 1.12.1908 - 31. 3. 1914
Knecht 1. 4.1914 - 31. 1. 1935
Michel 1. 2. 1935 - 1. 4. 1945
Schulz Mai 1945 - ?
Schmollke 1945 - 30. 9. 1950
Mohr 1.10. 1950 - 31.10. 1951
Michel 1.11.1951 - 6. 4. 1952
Weil Oberpostmeister 7. 4. 1952 - 5. 1955
Reminghof Oberpostm. 5. 1955 - 31. 5. 1962
Großstrangmann Postoberamtmann 1. 6. 1962 - 30. 9.1963
KröschelOberpostamtsrat 1.10. 1963 - 30. 6. 1977
Zimmermann Postamtsrat seit 1. 8.1977 –
Schluß des Postwesens
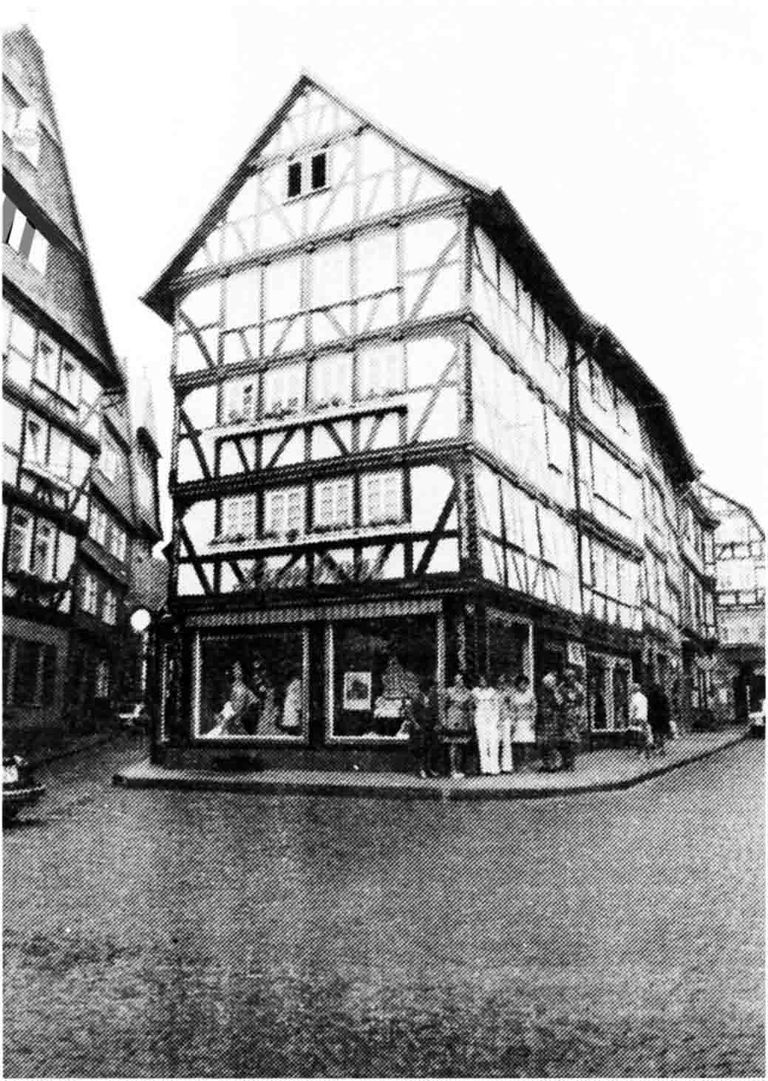
Das Haus Lambert am Marktplatz zu Fritzlar hat wieder eine gute Renovierung erhalten, wobei auch die Hausansicht in der alten Spitzengasse im Fachwerk wieder frei gelegt wurde. Nach seinem jetzigen Baustil ist das Vorderhaus um 1700 und die beiden nachfolgenden Bauabschnitte ins 16. Jahrhundert zu datieren. Den aufmerksamen Be-schauer wird an der Vorderfront des reichen Schnitzwerks die zusätzliche Eigenart von 9 Gesichtern, teils als Fratzen und teils als Engels- und Männerköpfchen auffallen, die in ihrer Symbolik das Haus schützen sollte.
Eine bescheidene geschnitzte Tafel an der Frontseite weist darauf hin, daß an dieser Stelle die ehemalige „Münze“ in Fritzlar stand. Alte Urkunden geben Nachricht von der frühen Existenz als Münzstätte und Gold-schmiedehaus, denn die meisten Fritzlarer Münzmeister waren auch gleichzeitig Goldschmiedemeister, von denen noch die reichen Gold-schmiedeschätze im Dom zu Fritzlar Zeugnis ablegen. Das Münzhaus, „moneta in acie“ wird in Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts häufig erwähnt, so zum Beispiel 1390, „heinrici Scherers sita in foro (Marktplatz) apud monetam“. In einem Stadtprotokoll vom 27. Juli 1701 wird berichtet, „daß die Mohrische Wittib ihre beeden Häuser, `die müntze und die stelze genannt´“, abgerissen und umgebaut werden. Die Bezeichnung „Münze“ für das Haus ist verständlich, der Beiname „Stelze“ ist wohl so zu verstehen, daß das alte Haus stelzenartig hoch gebaut war, oder daß es einen Umgang auf Stelzen hatte.
Für uns Menschen des 20.Jahrhunderts ist es wahrscheinlich nicht immer leicht zu begreifen,wie eine heute doch kleine Stadt wie Fritzlar eine eigene „Münze“, also Werkstätten zur Herstellung von eigenem Gelde besessen haben kann, und gleichzeitig damit auch eine Fritzlarer Währung besaß.
Prüft man in dieser Hinsicht die neusten Forschungen auf dem Gebiet der Numismatik (Münzkunde) und das vergangene Wirtschaftsleben unserer Stadt, so kommt für die meisten Leser ein erstaunliches Wirt-schaftgefüge des mittelalterlichen Fritzlars zu tage.
Für uns Menschen des 20.Jahrhunderts ist es wahrscheinlich nicht immer leicht zu begreifen,wie eine heute doch kleine Stadt wie Fritzlar eine eigene „Münze“, also Werkstätten zur Herstellung von eigenem Gelde besessen haben kann, und gleichzeitig damit auch eine Fritzlarer Währung besaß.
Prüft man in dieser Hinsicht die neusten Forschungen auf dem Gebiet der Numismatik (Münzkunde) und das vergangene Wirtschaftsleben unserer Stadt, so kommt für die meisten Leser ein erstaunliches Wirtschaftgefüge des mittelalterlichen Fritzlars zu tage.
Dr. Wolfgang Scheffler beschreibt in seinem umfangreichen Werk: „Goldschmiede Hessens“, Daten Werke Zeichen, Verlag W. de Gruyter, Berlin und New York, 1976 folgende Fritzlarer Goldschmiede:
1. Heinrich, Goldschmied, 13. Jahrhundert
2. Albertus, Aurifaber (Goldschmied) Todestag 20.8.1340
3. Paulus, Aurifaber, um 1360
4. Rucherus, Aurifaber, um 1360
5. Gerlacus, Goldschmied, vor 1390
6. Heyso, Aurifaber, um 1390. Hat Haus in der Krämergasse
7. Henricus Grundebuch, Aurifaber, um 1390. Hat ebenfalls sein Haus in der Krämergasse.
Nr. 8 bis 13 sind nachgewiesene Goldschmiede in Demandts „Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Fritzlar im Mittelalter“ aus dem 14. Jahrhundert.
14. Paul Goldschmied, 1408 - 25 nachweisbar in Rat.
15. Kurt Goldschmied, 1434 - 52 nachweisbar im Rat.
16. Berthold Goldschmied 11, 1438 - 44 nachweisbar im Rat.
17. Hermann, Goltsernd, hat 1502 Haus "uff dem Markte".
18. Gerhard, hat 1502 Haus „under dem Kremen“.
19. Wilhelm, Meister W. der Goldschmet, erhält 1577/78 Geld „die monstrantz zu machen“.
Außerdem waren über Jahrhunderte ein eigener Goldschmied beim Fritzlarer Chorherrenstift St. Peter beschäftigt. Eine derartige große Anzahl von noch nachweisbaren Goldschmiedne und Münzmeistern ist nur denkbar aus der voraus-gegangenen großen Kunst-Tradition in Fritzlar. Leider sind die Urkunden vor der großen Vernichtung 1232 verloren gegangen, aber die bedeutenden romanischen Kunstwerke und Münzen sind uns noch erhalten geblieben.
Ich gehe deswegen etwas eingehender auf dieses Thema ein, weil in neuerer Zeit der 70-er Jahre zwei Kunstwis-senschaftler das Ansehen ihrer Kunststädte wie Fulda und Corvey dadurch heben wollen, in dem sie die bedeutenden romanischen Kunstschätze von Fritzlar als Arbeiten ihrer Werkstätten nachzuweisen versuchen, trotzdem sie kein einziges Vergleichstück oder irgendwelche Urkunden besitzen die eine Verbindung mit dem alten Fritzlar beweist. Ihre Argu-mentation ist lediglich, das Fritzlar gar nicht die Voraussetzung für solche Kunstwerke aufbringen konnte. Ich habe damals schon in zwei Buchbesprechungen unter Hinwies von bedeutenden Kunstwissenschaftlern, die in ca. 85 kunstge-schichtlichen Abhandlungen Fritzlar als Kunststätte bezeichnen, dagegen Stellung genommen. Um so erfreulicher ist es, daß in den letzten drei Jahren hervorragende Neuforschungen zu Tage getreten sind, die unser Fritzlar in seiner großen Vergangenheit gerade im Kunstschaffen bestätigen. Darum möchte ich unseren Fritzlarern sagen, hütet eure Schätze, denn gerade im 20. Jahrhundert möchten so manche gierigen Hände danach greifen. Kommen wir nun zu den Fritzlarer Münzen, da gibt es in der Frühzeit die zweiseitigen Pfennige und die einseitigen Brakteaten. Ein Zufall will es, daß der älteste Fritzlarer Pfennig ein sogenannter Kölner Pfennig, unter Otto 1. als König 936 - 62 geprägt wurde, bei der Domgrabung am 4.6.1970 zu Tage kam und damit zu dem jüngsten Funde Fritzlarer Münzen zählt. Der Numismatiker Dr. Wolfgang Heß schreibt 1974 in seiner Forschungsdarstellung über „Fritzlars Münzwesen im Mittelalter“, folgendes: „Es entspricht der frühen Bedeutung Fritzlars, daß dieser Ort auch in der Münzgeschichte eine achtenswerte Rolle gespielt hat. Unter den hessischen Münzstätten läßt sich seine Tätigkeit am weitesten zurückverfolgen, in das erste Drittel des 11. Jahrhunderts. In den damals vergrabenen Schatzfunden kommen Fritzlarer Pfennige früher vor als andere aus Hessen stammende Gepräge.
(Fortsetzung folgt)
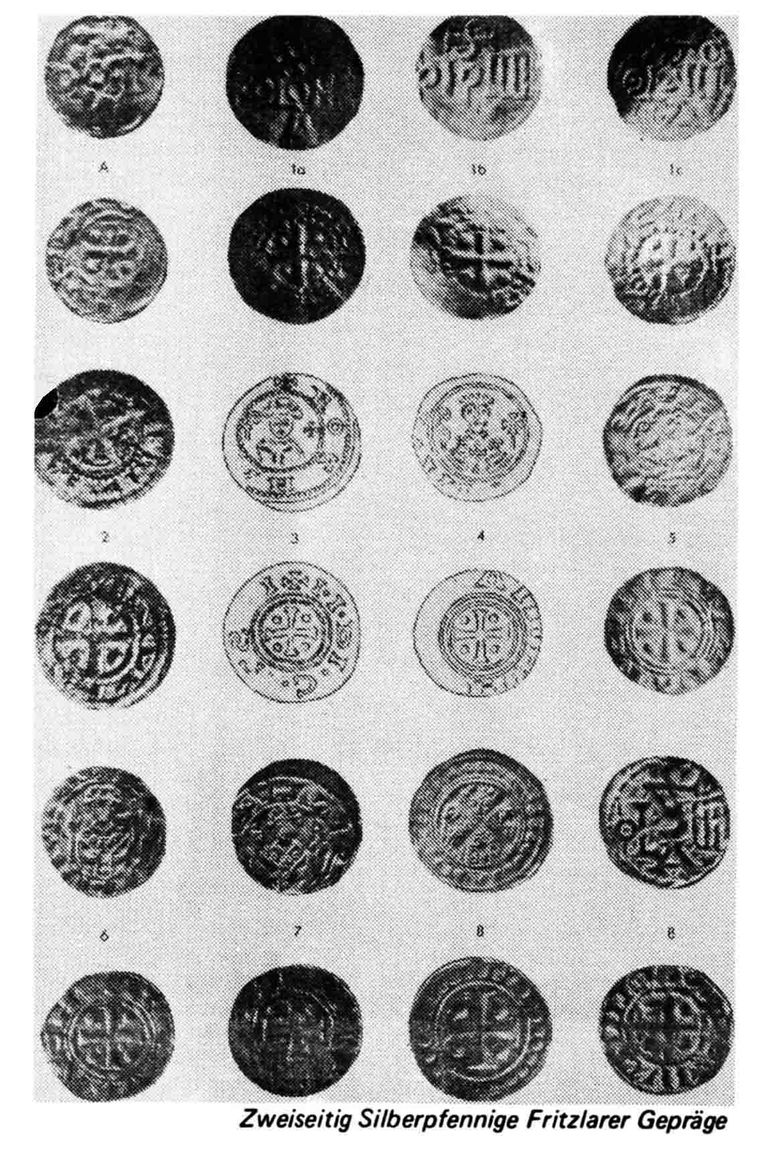
Um dem Leser einen besseren Wertüberblick eines Fritzlarer Silberpfennig auch Denar genannt zu geben, sei berichtet, daß um 900 diese Werteinheit sehr hoch war. Zum Beispiel bezahlte man 8 Silberpfennige für den Morgen Land und ein Ochse kostete 5 Silberpfennige, dessen Münzwert 350 Jahre später etwa um 1250 aber nur noch ein Zehntel so hoch im Werte stand. Aus: „Fritzlars Münzwesen des Mittelalters“, ein Forschungsbericht von Dr. Wolfgang Heß, in der Festschrift zur 1250-jährigen Jahrfeier, von Seite 242 bis 270, mit drei Münztafeln von 30 Sorten Fritzlarer Münzen stammen folgende Auszüge:
„Der älteste Fritzlarer Münztyp (Abb. 1a - c) ist ein silberner Pfennig, der auf einer Seite ein Kreuz mit je einer Kugel in den Kreuzwinkeln zeigt und außen herum, durch einen Perlkreis abgetrennt, die nicht ganz leicht lesbare Umschrift FRIDESLAR (0). Auf der Gegenseite befindet sich in drei Zeilen angeordnet, der Stadtname Kölns: Sancta/COLONIA/Agrippina. Die älteste Fritzlarer Münze reiht sich demnach ein in die zahllosen Nachahmungen der damals sehr verbreiteten Kölner Pfennige. Man kennt davon mehrere im Detail unterschiedlichen Gepräges,die mit verschiedenen Stempeln hergestellt sind. Datiert werden die Pfennige durch ihre Fundvorkommen. Ein Stück befand sich in dem 1965 entdeckten Schatz von Corcelles bei Payerne (Waad/Schweiz), der um 1035 vergraben wurde. Ein anderes kam bereits 1862 zum Vorschein, in dem bald nach 1037 vergrabenen Fund von Oster-Larskjer auf der dänischen Insel Bornholm, ein weiteres in dem um 1040 abgeschlossenen Fund von Lübeck. Es kommen 21 ganze und zwei halbierte Stücke dieses Typs hinzu aus schwedischen Funden, deren ältester sonst keine nach 1024 geprägte deutsche Münze enthielt. Die hier aufgezählten Fakten: Eine Fritzlarer Münze mit dem Namen Kölns, gefunden weit weg in Schatzfunden in der französischen Schweiz und von der Ostsee - das alles mag reichlich exotisch klingen, paßt wenig zu dem gängigen Bild von Hessen um die Jahrtausendwende oder bald danach. Dennoch gehören diese Fakten recht gut zusammen und werfen ein Schlaglicht auf das damalige Geld- und Münzwesen.
In jener Zeit war das gemünzte Geld noch ziemlich selten und fand in weiten Teilen Deutschlands überhaupt zum erstenmal Eingang. Der silberne Pfennig (Denar), dazu seinen nur an wenigen Orten geprägten Teilwert: Hälbling (Obol) und Vierling waren die einzige Münzsorte, weshalb diese Zeit in der Geldgeschichte den Namen „Pfennigzeit“ erhalten hat. Dieses Geld legte nach dem Zeugnis der damals vergrabenen Münzfunde oft erstaunlich weite Wege zurück. Die meisten deutschen Münzen des 10. und 11. Jahrhunderts sind aus Schatzfunden östlich der Elbe und Saale und aus den Ländern rund um die Ostsee bekanntgeworden, aus Skandinavien, Polen und dem Baltikum, ja selbst aus dem Innerem Rußlands. Gebiete also, die damals außerhalb der Reichsgrenzen lagen. Dorthin waren sie offensichtlich durch einen weitgespannten Handel gelangt, von dem wir sonst nur dürftige oder überhaupt keine Kunde aus Schriftquellen haben. Die im 10. und 11. Jahrhundert in Deutschland geprägten Münzen dienten also in hohem Maße dem Handel über weite Entfernungen. Aber auch im Wirtschaftsleben des Inlands hatte der „Fernhandelsdenar“ seinen festen Platz. Die Kaufleute, die ihn mit sich führten, gebrauchten ihn auf den Märkten. Dort galt Währungszwang. Es durfte nur in bestimmten Pfennigsorten bezahlt werden. Für Fritzlar ergibt sich aufgrund dieses Befundes, daß hier -ebenso wie auf anderen Märkten im benachbarten Westfalen- um die Jahrtausendwende der Kölner Pfennig gängige Münze war und dann nachgeahmt wurde. Ein glücklicher Zufall scheint diese Aussage zu bestätigen: Während der Domgrabung im Sommer 1970 wurde im Füllmaterial eines Grabes vor dem Roten Hals ein Kölner Pfennig aus der Königszeit Otto 1. (936-62) gefunden, von jenem Urtyp also, den die Fritzlarer Münze nachgeahmt hat.
Die Prägung des ersten Fritzlarer Pfennigs scheint sich über längeren Zeitraum erstreckt zu haben, wenn der Nachweis von je 3 und 5 verschiedenen Stempeln als Indiz gelten darf. Der nächste für diesen Typ gesicherte Münztyp ist aus dem 3. Viertel des 11. Jahrhunderts überliefert. Die Vorderseite zeigt das Brustbild eines barhäuptigen Geistlichen mit Krummstab und Kreuz. Die Umschrift: +S/IGEFRIDVS ARCHIEP(ISCOPUS) nennt als Münzherrn den Mainzer Erzbischof Siegfried I. (1060 - 84). Auf der Rückseite erscheint, um ein Kreuz mit Kugeln in den Winkel, der Ortsname +FRIEDES(LAR). Auch dieser Pfennig ist an mehreren Orten des Ostseeraumes gefunden worden, in Polna bei Leningrad, Lodejnoje Pole östlich des Ladogasees und Skadino bei Pskov südlich des Peipussees. Aufgrund der Funde läßt sich die Prägung dieses Typs in der Zeit vor 1075 datieren. Als weitere Zeugnisse zur Fritzlarer Münzgeschichte gesellen sich seit dem späteren 12. Jahrhundert zu den Münzen schriftliche Belege. In dem bekannten Rechenschaftsbericht, den Erzbischof Konrad zu seiner zweiten Amtsperiode verfaßte, wird unter den zurückgewonnenen Besitzungen des Erzstiftes auch die Fritzlarer Münze genannt. Sie war unter Konrads Vorgänger Christian (1165-83) für 130 Mark dem Landgrafen verpfändet gewesen und für den gleichen Betrag wieder eingelöst worden. Die Summe ist beachtlich, (d. h. etwa 30.400 Gramm) Silber angegeben.
Wohl kurz nach seiner Rückkehr auf den Mainzer Stuhl im Jahre 1183 hat Erzbischof Konrad die Einlösung der Fritzlarer Münze erreicht. Bereits der um 1185 abgeschlossene Fund von Gotha erhielt einen offenbar in Fritzlar geschlagenen Pfennig aus Konrads zweiter Amtszeit. Von den bisherigen Geprägen der Münzstätte unterscheidet er sich wesentlich: er eröffnet die Reihe der Fritzlarer Brakteaten.“ (Fortsetzung folgt)
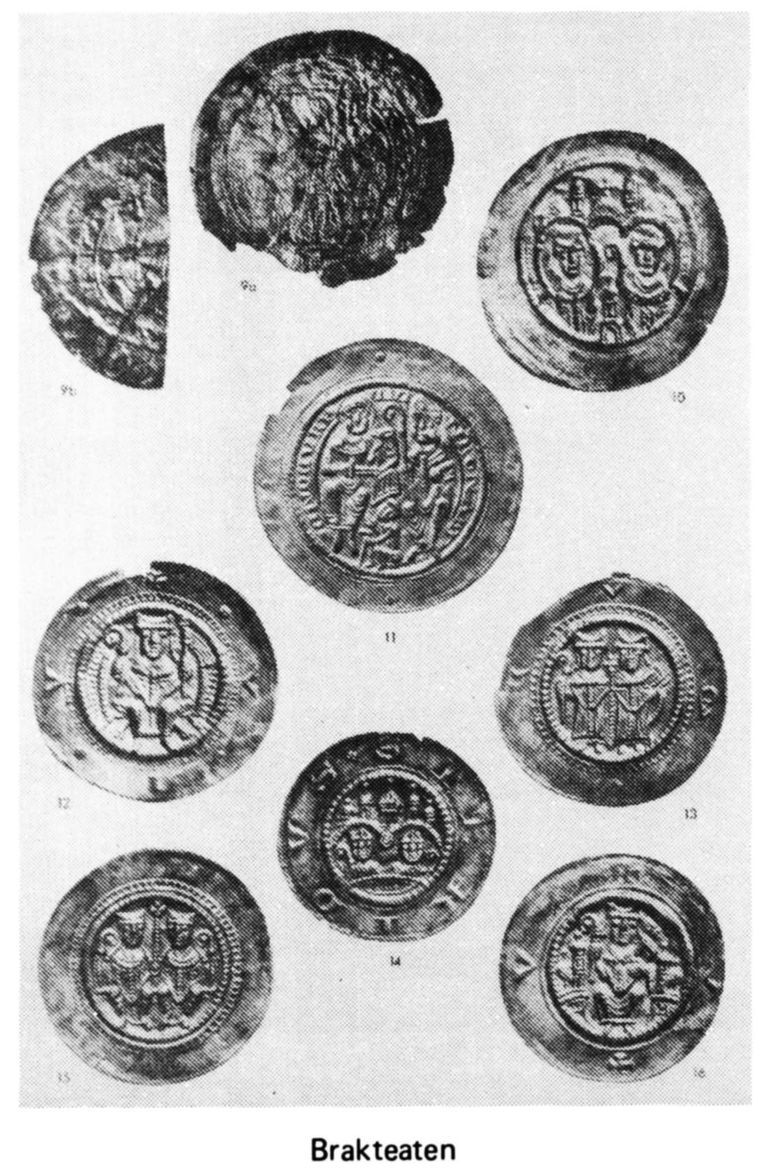
Nach den Silberpfennigen sind die Brakteaten einseitig geprägte Münzen mit starkem Relief, aus dünnem Schrötling in einer Art Treibarbeit hergestellt. Die neue Technik der Pfennigprägung, die auch den Vorteil hatte, daß anstelle eines Stempelpaares nur ein Prägeeisen benötigt wurde, breitete sich im 12. Jahrhundert rasch aus. In den zwanziger Jahren in dem Gebiet um Merseburg und Halle zuerst angewandt, übernahm sie Erfurt vor 1140, etwa zur gleichen Zeit auch Hersfeld, in Fulda ist sie später um 1160 nachweisbar, und vor 1170 wurden die ersten Wetterauer Brakteaten geschlagen. Fritzlar folgte erst jetzt. Die Verzögerung, etwa gegenüber Hersfeld, mag mit bedingt sein durch die Nachbarschaft Westfalens, wo man weiterhin bei den schweren zweiseitigen Pfennigen verharrte. Die Umstellung der Fritzlarer Münze auf die breiten einseitigen Pfennige wurde offenbar durch den erneuten Besitzwechsel ausgelöst. Am Anfang der Fritzlarer Brakteatenreihe steht ein Pfennig, dessen Umschrift Münz-herrn und Münzstätte nennt: CVNRADVS EP(is)C(opus) FRITSLAR (Abb. 9). Sein desolater Zustand läßt die be-merkenswerte Qualität des Gepräges nur noch bei detail-lierter Betrachtung unter der Lupe erkennen. Das nächste Münzbild zeigt nebeneinander thronend zwei Geistliche in Mitra. Der links (heraldisch „vorne“) Sitzend ist durch einen Palmzweig als Heiliger gekennzeichnet, ihm zur Seite erscheint offenbar der derzeitige Inhaber des Stuhls, Konrad. Daß mit dem heiligen Bischof, der ähnlich auch auf anderen Pfennigen vorkommt (Abb. 10), der Patron der Mainzer Kirchen, Martin, gemeint ist, wird durch die liebenswürdige Szene der Mantelteilung auf einem etwas jüngeren Stück bestätigt, das wohl ebenfalls noch zu Zeiten Konrads entstand.
Auch auf Erfurter Brakteaten des 12. Jahrhunderts ist Martin mehrfach abgebildet, und sogar für die Mantelteilung auf dem Fritzlarer Stück gibt es dort einen motivischen Vorläufer aus den siebziger Jahren. - Das Münzbild mit den beiden Mitraträgern findet sich dann auf vielen Fritzlarer Brakteaten während des ganzen 13. Jahrhunderts (Abb. 13-15, 17, 18). Es kann als besonders typisch für diese Münzstätte gelten. Auf den frühen Stücken ist der Heilige als solcher gekennzeichnet.
Auf den Hohlpfennigen aus den Jahrzehnten um 1300 überwiegt das Bild des Münzherrn. Die Formen sind hier fast zum Symbol reduziert. Das Bild des Erzbischofs allein kommt auch auf früheren Geprägen vor. Die Zuordnung solcher Stücke, die einen Geistlichen in Mitra zeigen, ist allerdings meist weniger sicher, da auch z. B. die Äbte von Fulda und Hersfeld in gleicher Gewandung auf ihren Münzen abgebildet sind. Wichtige Hinweise ergeben sich aus dem Vorkommen in Funden. So wird jener Pfennig, der einen thronenden Mitrierten mit Krummstab und Buch in einem Architekturrahmen zeigt (Abb. 16), der die Hauptmasse eines im Fritzlarer Dom entdeckten Fundes ausmachte, vergraben um 1230/35 (gefunden bei der Domrestaurierung Mitte 19. Jahrhundert). Von 47 bekanngewordenen Pfennigen waren 35, d. h. drei Viertel, Fritzlarer dieses Gepräges, die der hiesigen Münzstätte ent-stammen. Er war auch im Fund von Niederkaufungen vertreten, der noch andere entsprechende mit Bild eines Geistlichen enthielt, und für die ebenfalls Fritzlar vor anderen Prägeorten in Frage kommt, wie z. B. der Brakteat mit dem thronenden Kirchenfürsten auf Klappsessel (Faldistorium), der Krummstab und Fahne (Gonfanon mit vier Lätzen) hält (Abb. 12).
Die seit den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts reichlicher fließenden Schriftquellen enthalten zahlreiche für die Münzgeschichte interessante Nachrichten. Das Gebäude der Münze wird 1237 genannt, damals verkaufte die Witwe des Münzers Herdeni an Kloster Haina für die beachtliche Summe von 40 Mark Kölner Pfennige das steinere Haus bei der Münze mit allen zugehörigen Parzellen, samt Gebäude - allem Anschein nach ein ziemlich großes Anwesen. Das Areal stieß rückseitig an die Stadtmauer, wo nach der Zerstörung von 1232 neue Gebäude errichtet worden waren. Demnach lag die Münze noch nicht am Markt, wo sie im 14. und 15. Jahrhundert bezeugt ist." Soweit einige Auszüge aus W. Heß, Fritzlars Münzwesen.
Bei einer derart reichen Münzgeschichte von etwa 950 bis 1450 im mittelalterlichen Fritzlar, muß auch ein bedeutendes Wirtschaftsleben in unserer Stadt vorhanden gewesen sein. Staatarchivrat Dr. K. E. Demandt beschreibt uns, in einem Vortrag 1949, „Einwohnerschaft und Wirtschaftsleben im alten Fritzlar“, aufgrund der reichen Urkundenbelege wie folgt: „Die Entwicklung der Fritzlarer Einwohnerschaft und ihre hohe Blüte im 14. Jahrhundert, und der sich darin spiegelnde machtvolle und selbstbewußte Aufstieg der Stadt überhaupt, wird uns in seinen Gründen jedoch verständlich, wenn wir uns die wirtschaftlichen Grundlagen dieser Blütezeit klarmachen. Dabei ist von vorneherein eines streng zu betonen: es sind nicht die zahlreichen Liegenschaften an Äckern, Wiesen, Gärten und Weinberge, welche die Fritzlarer Einwohnerschaft im weiten Umkreis zusammenbrachte, also eine vorwiegend landwirtschaftliche Betätigung, die die Grundlage des Reichtums der führenden Fritzlarer Familien ausmachte, - es ist vielmehr allein ihre Handelstätigkeit und ihr Gewerbefleiß, auf dem ihr Wohlstand beruhte und erst dieser führt dann auch zu einem weit ausgedehnten Güterbesitz. Tatsächlich erscheint Fritzlar seit dem 13. Jahrhundert nicht nur im Besitz von bestimmten Jahr- und Wochenmärkten, sondern auch als ständiger Markt. Zu den beiden alten großen Jahrmärkten am 1. Mai und am 10. August kam 1464 noch ein dritter Jahrmarkt im Oktober hinzu. Im Mittelalter erstreckte sich der Einflußbereich des Fritzlarer Marktes über ganz Niederhessen und Waldeck, dessen überragender Handelsmittelpunkt unser Ort im ganzen Mittlalter gewesen ist, bis es dann in nachmittelalterlicher Zeit diesen Rang an die neuaufkommende Residenz in Kassel verlor.
(wird fortgesetzt)

Die Größe des Fritzlarer Wirtschaftsgebietes im Mittelalter ist naturgemäß nur ungefähr festzulegen, aber der Gebrauch von Fritzlarer Münzen und Maß, welche seine Ausdehnung am sichersten kennzeichnet, erstreckte sich vom nördlichen Hessen bis in das Ziegenhainer Gebiet und im 14. Jahrhundert sind hessische Pfennige und Fritzlarer Währung geradezu identisch. Als der Fritzlarer Rat im Jahre 1405 eine Neuordnung des städtischen Geldwesens vornahm und eine Preisregelung für Tuche, Getreide, Nahrungsmittel und sonstige Kaufmannsgüter vornahm, nennt er als angrenzende Wirtschaftsgebiete Westfalen, Sachsen und das Frankfurter Währungsgebiet. Auf diese beherrschende Stellung des Fritzlarer Marktes weist auch das schon im 13. Jahrhundert völlig ausgebildete Gästerecht hin, d. h. die Feststellung der Bedingung unter der auswärtige Kaufleute in Fritzlar Handel treiben konnten. Sie mußten bei der Bedeutung der Fritzlarer Märkte um so mehr angezogen werden, als der Ort durch seine günstige Straßenlage dem großen Handelsverkehr besonders erschlossen war. Als Kreuzungspunkt bedeutender und alter Fernverkehrsstraßen hatte es unmittelbare Verbindungen nach Thüringen, Niedersachsen und West-falen, nach dem Siegerland und insbesondere in die unteren Main- und mittleren Rheingebiete. Welche Gütermengen auf nur einer, allerdings der wichtigsten dieser Strassen, nämlich der rheinischen, durch Fritzlar durchgeführt wurde, können wir daraus ermessen, daß eine nur vorübergehende im Jahre 1346 vom hessischen Landgrafen erzwungene Umleitung dieses Verkehrs der Stadt allein einen Zollverlust von 1.000 Mark zufügte, eine Summe, die dem mehr als zwanzigfachen Wert des heutigen Geldes bedeutet; von dem Umsatzgewinn ist dabei nicht einmal die Rede. Sie waren wahrscheinlich noch größer, denn seit frühester Zeit wurden auf den Fritzlarer Märkten die wertvollen Fernhandelssachen wie kostbare Tuche, Pelze, Seide, Gewürz, Spezereien, Südfrüchte und Weine gehandelt. Zudem war Fritzlar ein hervorragender Handelsplatz für Getreide und Wolle. Ein wichtiges städtisches Getreideprivileg, das aller und besonders in kriegerischen Zeiten in die Stadt gebrachte Frucht erhöhte Rechtssicherheit verbürgt, hat nicht nur die städtische Brot-versorgung auch in den schwierigen Zeiten sicher gestellt, sondern damit auch im Frieden den gesamten Getreidehandel aus der weiten, fruchtbaren Fritzlarer Ebene in die Stadt konzentriert. Das aber bedeutet nicht nur beträchtliche Umsatzgewinne für die städtische Bürgerschaft, sondern auch ein erhebliches Steueraufkommen für die Stadt, da diese seit 1269 von jedem dort selbst verkauften Scheffel Getreide eine besondere Taxe erhob. Nicht minder bedeutsam war der Wollmarkt, der besonders im 16. Jahrhundert, einen ganz beträchtlichen Umfang erreichte und außer den kleineren Handelsherren hessischer Städte auch zahlreiche Frankfurter und Kölner Großkaufleute zum Einkauf nach Fritzlar geführt hat, denn es war neben Frankenberg der bedeutenste Wollstapelplatz Hessens.
Ich glaube, sie alle werden es kaum für möglich gehalten haben, daß allein im Winter 1600 die Frankfurter Wollgroßhandlung Soreau von dem Fritzlarer Großkaufmann Siegfried Heinemann etwa 1.500 Zentner Wolle im Wert von ca. 20.000 Thalern eingekauft hat. Diese auch für heutige Begriffe gewaltigen geschäftlichen Transaktionen zeigen, welches Wollgeschäft in Fritzlar möglich war.
Ich möchte aber meinen Überblick über den Fritzlarer Markt nicht abschließen, ohne ihre Aufmerksamkeit auf zwei ganz besondere und kostbare Erzeugnisse und Handelsartikel hinzuweisen: Nämlich die heraldischen und die Goldschmiedearbeiten. Unter heraldischen Arbeiten verstehen wir, den Wappenschmuck der ritterlichen Rüstung, also insbesondere die Ausstattung der Schilde, Helmzierden, Wappenröcke, Pferdedecken und Banner. Dieses Kunsthandwerk wurde von den Schilderern ausgeübt und ihr Gewerbe war so bedeutend in unserer Stadt, daß es eine ganze Straße, der Schildergasse den Namen gegeben hat. Er ist schon im frühen 13. Jahrhundert bezeugt und stellt außer der Fleminggasse, die nach den flämischen Wollwebern benannt war den einzigen Fritzlarer Straßennamen dar, der nach einem Berufsstand gebildet war. Da die Erzeugnisse der Kunst der Schilderer in Fritzlar selbst natürlich nicht unterzubringen war, müssen sie für eine auswärtige Abnehmerschaft gearbeitet haben, und als solche kommt nur der hessische Adel in Frage, dessen enge Beziehung zur Stadt durch das dortige Stift gegeben waren, da dieses bis in das 14. Jahrhundert nur Herren adeliger Abkunft offenstand. Daraus erklärt sich die Konzentrierung dieses Gewerbes in Fritzlar. Naturgemäß ist von seinen vergänglichen Schöpfungen nichts mehr erhalten, wenn nicht die herrlichen ältesten Totenschilde der hessischen Landgrafen in der Elisabethkirche in Marburg, wo ein solches Handwerk damals nicht nachweisbar ist, als Fritzlarer Arbeiten angesprochen werden dürfen.
Nicht minder große Leistungen aber kommen den Fritzlarer Goldschmieden zu. Hier hat sich in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in der Nachfolge des Meisters Roger von Helmarshausen eine Goldschmiedeschule entwickelt, deren großartige Arbeiten noch heute die Schmuckstücke des hiesigen Domschatzes bilden. Aber es ist selbstverständlich, daß eine solche Schule mehrerer Meister und ihrer Gehilfen nicht nur für den Bedarf einer einzigen Kirche gearbeitet haben kann, sondern eines größeren Absatzgebietes bedurfte, um bestehen zu können. Sind doch aus dem spätmittelalterlichen Fritzlar allein 20 Goldschmiedemeister urkundlich bekannt geworden, woraus mit Sicherheit zu schließen ist, daß ihre Arbeiten gängigen Absatz gefunden haben. Als Träger des Fritzlarer Groß- und Fernhandels im späten Mittelalter haben wir die in der Michaelsbruderschaft vereinigten Fritzlarer Kaufleute und Patrizier anzusehen. Ihre Tätigkeit beschränkt sich selbstverständlich nicht nur auf den Fritzlarer Markt, sondern erstreckte sich weitgehend auf die westdeutschen Märkte, denn wir hören nicht nur von ihren Handelsbeziehungen nach Kassel und Giessen, von ihren Tätigkeiten auf den großen Messen in Frankfurt und Leipzig, sondern auch von ihren Geschäften in Köln und selbst in Flandern, wo 1355 ein Schöffe und Handelsherr der Stadt Roermund die Fritzlarer Bürger Heinrich Katzmann und Johann von Holzheim in ihren Geschäften geschädigt hatte.
(Schluß folgt)

Die Haupthandelsartikel der Michaelsbrüder waren Wolle und Wein, Tuche und Pelze, die sie im Klein- wie im Groß-vertrieb umsetzten, während sie für Lebensmittel, Speze-reien und Gewürze, Kleidung, geringere Stoffe und Pelze, Mineralien, Leder und Seidenwerk, Geräte und Metalle, deren Kleinverkauf den Fritzlarer Krämern vorbehalten war, nur als Großhändler aufgetreten sind. Dazu aber kamen ausge-dehnte Geldgeschäfte, für die ihnen bei dem völligen Fehlen aller mittelalterlichen Bank- und Kreditinstitute ein weites Betätigungsfeld offenstand. Ich will hier nur die gewinn-bringenden Anleihen erwähnen, welche die Fritzlarer den hessischen Landgrafen gewährt haben, und wofür sie ent-weder Liegenschaftsanweisungen oder Sicherheitsleistungen durch andere hessische Städte erhielten, welche auch die Zinsen zu tragen hatten. Bei der hierzu erforderlichen Kapi-talkraft aber kommen für die Geschäfte auch wieder nur die in der Michaelsbruderschaft vereinigten Großhändler in Frage. Es gehören ihr nur die ersten, also vornehmlich die Patr-izischen Familien (sogenannter Stadtadel) an und dement-sprechend war auch das Eintrittsgeld vor allem im Vergleich mit den übrigen Fritzlarer Zünften sehr hoch bemessen. Es betrug außer den üblichen Wein- und Wachsspenden und einem Betrag an den Bruderschafts-diener 3 1/4 Mark Silber. Zudem verfügte die Bruderschaft über ein ansehnliches Gesellschaftsvermögen, das überwiegend in Grund-stücks-beleihung angelegt,war, so daß ihr in der Stadt Ende des 14. Jahrhunderts über 60 Häuser und Grundstücke zinspflichtig waren; außerdem hatte sie das städtische Bad gepachtet, dessen Betrieb ihr gleichfalls eine gute Einnahmequelle brachte. Aus dieser Kapitalbildung aber ist ebenso wie aus der gewinnbringenden Verwaltung öffentlicher Anstalten mit Sicherheit zu entnehmen, daß die Bruderschaft schon im 14. Jahrhundert korporativ als kaufmännische Gesellschaft auf-getreten ist. Ihr Geschäftsmittelpunkt war das 1333 bezeugte Gewandhaus, worunter wahrscheinlich eines der 1248 genannten Fritzlarer Kaufhäuser am Markt zu verstehen ist und daneben standen ausschließlich ihr die in den unteren Gewölbehallen des Rathauses eingerichteten Kaufstände zu, was abermals ihre führende Stellung im Fritzlarer Wirtschaftsleben eindeutig nachweist. Der Fernhandelstätigkeit und Kaufmannschaft umfassende Art, die ausschließlich von dem in der Michaelsbruderschaft wirtschaftlich zusammengeschlossenen Patriziat betrieben wurde, steht das eigentlich städtische Gewerbe in Gestalt des in den Zünften vereinigten Handwerk gegenüber.
Im 13. Jahrhundert sind sie noch nicht nachzuweisen. Sie scheinen erst zu Ende desselben entstanden zu sein, haben aber schon im Verlauf des 14. Jahrhunderts eine hohe Blüte erreicht. Auch für diese Zusammenschlüsse waren vor allem wirtschaftliche Gründe bestimmend. Es erscheinen insbesondere der korporativ wirksame auszuübende Gewerbeschutz und die wirtschaftliche Sicherung des Einzelnen durch gemeinsame Preisbildung und Gütekontrolle der Waren, die Ausschaltung des unlauteren und fremden Wettbewerbs und die gemeinschaftlich nachdrücklich mögliche rechtliche Vertretung gewesen zu sein, die zunächst zu einem loseren, dann strafferen Zusammenschluß führten, der schließlich zu einem Beitrittszwang für alle Gewerbetreibenden eines Handwerks geworden ist. So sind dann aus diesen mannigfachen und doch in allen Fällen gleichartigen Gründen im Laufe des 14. Jahrhunderts folgende 15 Fritzlarer Zünfte ins Leben getreten: Die Wollweber, die Bäcker, die Metzger, die Schuster, die Gerber, die Krämer, die Schneider, die Schmiede, die Leineweber, die Höker, die Fischer, die Brauer, die Zimmerleute und Böttcher. Von entscheidender Bedeutung war für die Zunftmitglieder naturgemäß die gemeinschaftliche Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen nach außen und innen. Infolgedessen übernahm es die Zunft als Hüterin eines Gewerbemonopols, ihr Privileg gegen Eingriffe oder Beeinträchtigungen durch Außenstehende zu schützen. Und in gleicher Weise vertrat die Zunft die wirtschaftlichen Belange ihrer einzelnen Mitglieder innerhalb der Bruderschaft. Vier Punkte sind hierbei vorherrschend: der gerechte Preis, die Güte der Ware, die Rohstoffbeschaffung und der Produktionsausgleich.
Die Preispolitik, die ein besonderes Kennzeichen der Stadtwirtschaft ist, und in letzter Instanz immer im Rat gemacht wurde, erfaßt eine ganze Folge von Maßnahmen und gipfelt im Ringen um den gerechten Preis wie die berühmte mittelalterliche Begriffsschöpfung lautet, und um die Sicherung der Bedarfsdeckung, soweit sie die Lebensmittelversorgung betrafen. Hierher gehören als grundlegende Voraussetzung die Münz- und Währungsmaßnahmen in Gestalt der Feingehaltsfestsetzungen für die Münzprägungen und die Bestimmungen über den Kurs und das gegenseitige Wert-verhältnis der verschiedenen Münzsorten, denn im mittelalterlichen Fritzlar war ja nicht nur das einheimische, dort selbst in der Münze am Markt geprägte Geld gültig, sondern wie sich das bei den weitgespannten Fritzlarer Handelsbeziehungen und der Buntscheckigkeit des mittelalterlichen Münzwesens in Deutschland von selber ergibt, auch eine sehr große Anzahl fremder Geldsorten im Umlauf. Als Geldeinheit des 14. und 15. Jahrhunderts sind da etwa zu nennen: Gulden und Pfund, Mark und Schilling, die schweren und leichten Groschen, die Weiß- und Wegpfennige, sowie Heller, Hälbling, Duttener, Mutzen und Drachmen und alle Münzsorten die mittel- und niederrheinischen und insbesondere die wetterauischen Prägungen mit dem Frankfurter, Friedberger, Wetzlarer, Münzenberger und Assenheimer Geld, die hessischen und waldeckischen Münzen, wie das Marburger, Kasseler und Korbacher Gepräge und die in der Fritzlarer Münzordnung von 1405 außerdem genannten böhmischen, meißnischen und märkischen Münzen. Also eine geradezu verwirrende Fülle, die allein an die Geldkenntnis der Handel- und Gewerbebetreibenden außerordentliche Anforderungen stellte, wenn sie nicht schwere Kurs- und Wertverluste erleiden wollten. Hier hat der Rat dann wiederholt durch neue Kurs- und Wertbestimmungen eingegriffen, dabei aber nicht haltgemacht, sondern auch verbindliche Lohnfestsetzungen getroffen, sich um den Preisausgleich und die Preisanpassung zwischen den einzelnen Handwerken bemüht.“
Soweit die Auszüge aus dem Vortrag „Das Wirtschaftsleben im alten Fritzlar“, von Staatsarchivrat Dr. K. E. Demandt. Aus all diesen urkundlichen neueren Forschungen ergibt sich, daß Fritzlar die ehemalige Landeshausptstadt Niederhessens, ein lebendiges Münz- und Wirtschaftszentrum war und somit auch die Grundlage zu einem reichen Kunstschaffen in unserer Stadt gegeben war, und nicht wie heute schlecht informierte Buchschreiber wiedergeben: „Daß Fritzlar bei seinem kulturellen Allgemeinstand doch einfach nicht die Voraussetzungen geboten haben könne, für solche umfassende künstlerische Tätigkeit“.
Wochenspiegel Nr. 35/12 vom 31. August 1978, S. 1-2
Fritzlar als lebendige Stadt war auch der Kulturträger im mittelalterlichen Hessen.
Vom Verfasser wurde Ihnen, sehr geehrte Leser, aufgrund urkundlicher Belege nachgewiesen, daß Fritzlar im Mittelalter die Landeshauptstadt Niederhessens war. Und zwar eine lebendige Stadt mit pulsierendem Wirtschaftssystem und besonderen Handwerksfähigkeiten durch Goldschmiede und Schilderer beispielsweise. Handwerke, die noch heute jede Großstadt Leserinnen und auszeichnen. So ist der Verfasser in Köln auf eine Schilderstraße gestoßen, eine Hauptgeschäftsstraße, die unmittelbar mit der bekannten Hohenstraße zusammentrifft.
Die Geschichtsforschung kommt erst jetzt langsam zur vollen Klärung, da in der monarchistischen Zeit die Archive von Staat und Kirche nur schwer zugänglich waren, aus Angst es kämen Dinge ans Tageslicht, die den jeweiligen Besitzern solcher Archive schaden könnten. Nach dem ersten Weltkrieg (1914/18) wurden die Archive zum großen Teil verstaatlicht und stehen seit dem der Forschung offen. Trotzdem brauchen wir noch viele Jahre, bis neue Generationen von Wissenschaftlern ausgebildet sind, um die Archive zu durchforsten. Fritzlar hat auf diesem Gebiet schon tüchtige Wissenschaftler gefunden wie etwa den Oberarchivrat Dr. Demandt und viele andere. Alle diese Forschungen werden nicht unserer Stadt zuliebe betrieben, sondern weil man bei der Beurteilung der deutschen Reichs- und Kirchengeschichte an Fritzlar nicht vorbeikommen kann. 11 deutsche Kaiser, 24 Reichs- und Kirchentagungen sowie das adlige Chorherrenstift haben ihre Spuren hinterlassen. Deswegen seien die Leser noch auf ein bisher wenig erforschtes Gebiet hingewiesen, welches erst in neuester Zeit bekannter wurde, es handelt sich um die berühmten Handschriften aus Fritzlar. Der Besitz von wissenschaftlichen Handschriften war zu allen Zeiten der Gradmesser für die kulturellen Leistungen einer Stadt und des jeweiligen Landes. 1960 hatte die deutsche Forschungsgemeinschaft mit einem Kostenaufwand von 56.000,DM den ersten Band „Manuskripte Juristica“, also Schriften über das Rechtswesen herausgegeben. Bearbeitet wurde das Buch von Marita Kremer und Dr. Ludwig Denecke in Zusammenarbeit von 14 Professoren und 16 Doktoren unter dem Titel „Die Handschriften der Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel und der Landesbibliothek“. Schon in diesem Band hat Fritzlar einen Anteil von 90% der wertvollen mittelalterlichen Schriften vom 9. bis 15. Jahrhundert. 1976 erschien der zweite Band unter dem Titel „Manuscripta Medica“, also Medizinische Handschriften, bearbeitet von Dr. Hartmut Broszinski und 12 Professoren, zwei Bibliotheksdirektoren und 16 Doktoren. Einen Ausschnitt der Einleitung berichtet folgendes: „Es ist auffällig, daß die Kasseler Bibliothek vor 1800 fast keine mittelalterlichen medizinischen Handschriften besaß. Ähnlich wie in der Gruppe `Manuscripta juridica´ stammt die überwiegende Zahl der medizinischen Handschriften aus dem Kollegiatstift St. Peter in Fritzlar.“
Diese vierzehn Handschriften stellen auch den größten Block innerhalb des Bestandes dar; sie gehören zu jenen rund 200 Manuskripten, die bei der Säkularisierung des Stiftes 1804 nach Kassel kamen. Nur zum Teil sind sie mit jenen ausdrucksvollen Fritzlarer Exlibris aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gekennzeichnet, die Petersschlüssel und Tiara zeigen. Auch im medizinischen Bestand weisen ausschließlich Fritzlarer Bände Kettenspuren auf; ein weiteres Indiz also für die Bestimmung Fritzlarer Provenienz, wo Exlibris fehlen. Nicht alle freilich sind so gekennzeichnet: 4o Ms. med. 19 entstand erst nach der Zeit, in der Katenisierung in Fritzlar üblich war, 4° Ms. med. 18 ist nur ein einbandloser Faszikel, 8° Ms. med. 10 erst im späteren 15. Jahrhundert im Stift zusammengesetzt. Ferner sind braun angestrichene Buchrücken für Fritzlar charakteristisch. Betrachten wir nun die Signaturen der Fritzlarer Handschriften, fällt sofort die Blockbildung auf: 2° Ms. med. 3 bis 8, 4° Ms. med. 15 bis 19 und 21. Daß 4°Ms. med. 20 ausgelassen ist und 8° Ms. med. 10 vereinzelt steht, hat besondere, weiter unten dargelegte Gründe. Der Schreiber des Kasseler Bandkataloges trug den größten Teil der Handschriften nach der Übernahme also blockweise ein. Die nachträgliche Bestätigung der Zuweisung aller vierzehn Manuskripte nach Fritzlar ist dem Auffinden eines handschriftlichen Kataloges der Fritzlarer Stiftshandschriften aus dem Jahre 1774 zu verdanken. Der Kapitular und Scholaster Johann Philipp von Speckmann (1713-1776) hatte dieses auf Pergament geschriebene Verzeichnis verfaßt, das 1968 im Handschriftenmagazin der Murhardschen und Landesbibliothek entdeckt wurde, freilich noch keine Signatur trägt. Eingehend behandelt und überzeugend interpretiert wurde der Katalog vom früheren Direktor der Bibliothek, Ludwig Denecke (Fritzlar im Mittelalter, Festschrift zur 1250-Jahrfeier, Herausgeb. Magistrat der Stadt Fritzlar, Fritzlar 1974, S. 222-241). Es war „einer jener guten Zufälle“, daß Denecke das Katalogmanuskript in die Hand bekam. Der Katalogtext gibt zunächst so gut wie nichts her, wird man doch durchweg mit so lapidaren Angaben wie „Tractatus medicus in pergameno“ konfrontiert. Angaben die nun wirklich nicht zur Identifizierung einer Handschrift ausreichen. Doch zum einen sind bei manchen Handschriften noch Signaturenschildchen mit Nummern erhalten, die denen des Katalogs entsprechen, wenn auch nicht ohne gelegentliche Fehler; zum anderen, und das ist das Entscheidende, erkannte Denecke, daß die Handschriften von Speckmann ganz dem Brauch der Zeit entsprechend, einfach der Größe nach geordnet worden waren. Innerhalb einer bestimmten Buchrückenhöhe hatte der würdige Fritzlarer Kapitular dann nichts dagegen, daß Zusammengehöriges auch zusammenblieb. „Nun war es in den meisten Fällen relativ einfach, eine Konkordanz aufzustellen.“ Soweit ein Auszug aus der neuesten Forschung über Fritzlarer Handschriften. In dem Bibliothekarsdirektor Dr. Denecke hat Fritzlar einen großen Fachwissenschaftler gefunden, der seit 1974 bis heute fünf wissenschaftliche Arbeiten über den hohen Stand der Handschriftenkultur in Fritzlar für die deutsche Forschung geleistet hat.
Wie wir erfahren, hat die Landesbibliothek in Kassel ca. 200 Handschriften 1804 bei der Säkularisierung von Fritzlar erhalten, von denen erst ein Drittel wissenschaftlich bearbeitet sind. Der Dom in Fritzlar besitzt heute noch ca. 122 Handschriften. Schloß Pommersfelden bei Bamberg, der Sitz der Schönborn'schen Grafen, die zum Teil Erzbischöfe von Mainz waren und damit zugleich Stadtherren von Fritzlar, haben sich im 18. Jhr. 48 Handschriften-Prachtbände vom Stift Fritzlar schenken lassen, die heute wie damals hohe Werte darstellen. Die Dombibliothek zu Fulda besitzt ebenfalls Handschriften aus Fritzlar. Aus diesen Tatsachen erkennt man, wie reich Fritzlar an wissenschaftlichen Schriften war. Nun ist eine Handschrift keineswegs ein beschriebenes Blatt Pergament, sondern es sind meistens umfangreiche Pergamentbände. z. B. hat die Landesbibliothek in Kassel einen Band wie folgt bezeichnet: 2° Ms. iurid. 4 aus dem 14. Ihr. (Manuskript der Rechtswissenschaften) welches sich über fünf Bände erstreckt und 1394 Blatt hat. Diese Handschriften wurden früher zum Erlernen der verschiedenen Wissenschaften benötigt, da ja Fritzlar die Hochschule für Niederhessen war, welche durch die Reformation und die Gründung der Universität Marburg ihre Bedeutung verlor.
Folgende Wissenschaftsgebiete sind z. B. im „Catalogus manuscriptorum“ in der Aufgliederung nach Fächern durch Dr. Denecke beschrieben worden: „Liturgica (68), Theologica (33), Juridica (86), Medica (15), Hassiaca (7), Philologica (5), Philosophica (3), Physica et hist. nat. (2)“. Auf Grund dieser Tatsachen gehörte Fritzlar zu den alten Städten im Römischen Reich Deutscher Nationen, wo alle Bedingungen einer kulturellen Voraussetzung gegeben waren.
Hans Josef Heer